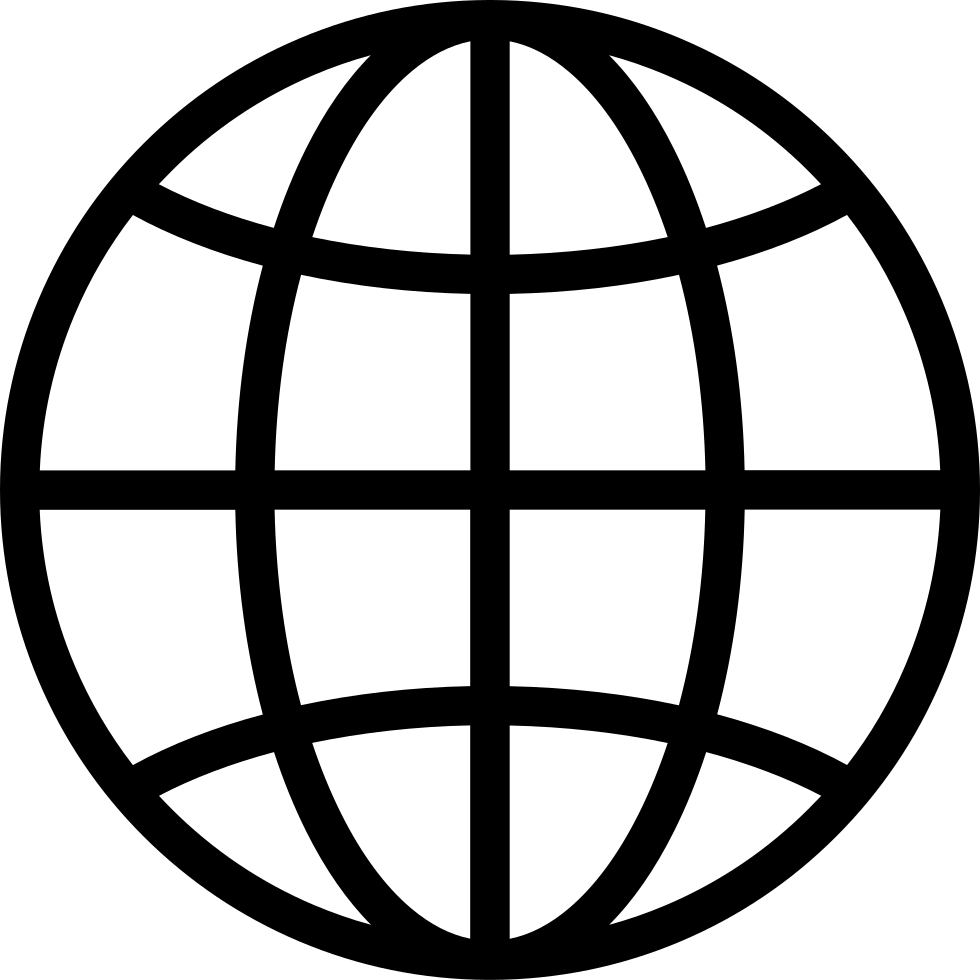Player FM - Internet Radio Done Right
13 subscribers
Checked 12d ago
Adăugat one an în urmă
Content provided by Andreas Filipovic, Walter Szevera, Andreas Filipovic, and Walter Szevera. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by Andreas Filipovic, Walter Szevera, Andreas Filipovic, and Walter Szevera or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://ro.player.fm/legal.
Player FM - Aplicație Podcast
Treceți offline cu aplicația Player FM !
Treceți offline cu aplicația Player FM !
Podcasturi care merită ascultate
SPONSORIZAT
M
Mind The Business: Small Business Success Stories

1 The SB Starter Kit - Everything You Need or Need to Know to Get Your Business Off the Ground (Part 1) - Trademarks, Patents, LLCs and SCorps 35:28
35:28  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut35:28
Plăcut35:28
Step one for starting a small business is often coming up with an exciting idea. But what is step two? Step three? Steps four through launch and beyond? On our second episode, and first iteration of our Small Business Starter Kit Series, Austin and Jannese visit The Candle Pour to chat with founders Misty and Dennis Akers . They’ll tell our hosts about how they got their business off the ground and about all the things that go with it: from incorporation to trademarks. Join us as they detail how they went from Grand Idea to Grand Opening. Learn more about how QuickBooks can help you grow your business: Quickbooks.com See omnystudio.com/listener for privacy information.…
Die Geschichtsgreißlerei
Marcați toate (ne)redate ...
Manage series 3512774
Content provided by Andreas Filipovic, Walter Szevera, Andreas Filipovic, and Walter Szevera. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by Andreas Filipovic, Walter Szevera, Andreas Filipovic, and Walter Szevera or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://ro.player.fm/legal.
History goes Grätzl! - Ausgehend von Wiener Orten behandelt die Geschichtsgreißlerei historische Themen und aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Sie erzählt Unbekanntes und Unerhörtes über Wien und spannt den Bogen weit darüber hinaus.
…
continue reading
40 episoade
Marcați toate (ne)redate ...
Manage series 3512774
Content provided by Andreas Filipovic, Walter Szevera, Andreas Filipovic, and Walter Szevera. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by Andreas Filipovic, Walter Szevera, Andreas Filipovic, and Walter Szevera or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://ro.player.fm/legal.
History goes Grätzl! - Ausgehend von Wiener Orten behandelt die Geschichtsgreißlerei historische Themen und aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Sie erzählt Unbekanntes und Unerhörtes über Wien und spannt den Bogen weit darüber hinaus.
…
continue reading
40 episoade
כל הפרקים
×Das verkaufte Silber der Republik Der Inhalt: Während des Zweiten Weltkriegs wurden zahlreiche Rüstungs- und Grundstoffindustrien in Österreich gegründet, die vor der Okkupation durch Hitler-Deutschland 1938 nicht existent waren. Dabei wurden entweder neue Fabriken gegründet oder eine Fusionierung und Konzentration bestehender Industriezweige vorgenommen. Nach dem Krieg wurde dieses ehemalige deutsche Eigentum in mehreren Verstaatlichungsgesetzen in den Besitz der Republik überführt. Dies betraf vor allem Stahl-, Chemie- und Energieproduzenten, sowie die wichtigsten Banken. Diese „Verstaatlichte Industrie“ (VI) bildete für 3 Jahrzehnte das Rückgrat des österreichischen Wirtschaftsstandorts. Die Krise der Rohstoffindustrie traf auch die VI ab Ende der 1960er Jahre hart. Entnommene und nicht reinvestierte Gewinne, Unterkapitalisierung und zu billig an die Privatindustrie verkaufte Produkte machten die Sanierung der VI zum Politikum. Aber auch Fehlinvestitionen und fragwürde Geschäfte setzten dem Konzern hart zu. Am Höhepunkt beschäftige die VI über 100.000 Menschen in Österreich, danach wurde sie sukzessive zerschlagen und privatisiert. Auch in Wien waren zahlreiche Firmen nach dem Krieg verstaatlicht, daneben gab es auch die Zentralen der großen Banken. Somit war auch die VI in Wien maßgeblich für den Wirtschaftsaufschwung bis in die 1970er Jahren verantwortlich. Der Ort: Erzherzog Karl-Straße 127, 1220 Wo heute die Filiale einer internationalen Baumarktkette steht, befand sich das ehemalige Stahl- und Maschinenbauwerk von Waagner-Biró. Nachdem die Aktienmehrheit nach dem Anschluss von der Länderbank in die Dresdner Bank transferiert wurde, fiel die Firma unter Deutsches Eigentum und wurde nach 1955 verstaatlicht. Waagner-Biró gehörte zu den wichtigsten Industriebetrieben Wiens. Heute findet man noch einige denkmalgeschützte Industriefassaden an der Originaladresse. Der Gast: Ferdinand Lacina war 1982 bis 1984 Staatssekretär im Bundeskanzleramt und für Wirtschaftsfragen verantwortlich. 1984-1986 bekleidete er das Amt des Ministers für Verkehr und von 1986 bis 1995 für Finanzen. In seine Amtszeit fielen aufgrund der ökonomischen Umwälzungen die meisten Umstrukturierungen der VI. Tipps und Tricks: Zum Lesen: Dieter Stiefel: Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich: Illusion und Wirklichkeit. Wien 2011 Georg Turnheim: Österreichs Verstaatlichte. Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis 2008. Wien 2009 Zum Schauen: Egon Humer: Postadresse: 2640 Schlöglmühl. Prisma Filmproduktion 1990…
Soziale Fürsorge in Wien Der Inhalt: Armenfürsorge und Wohlfahrt spielten schon im mittelalterlichen Wien eine wichtige Rolle. So gab es neben dem von der Kirche unterstützten Heiligengeistspital auch das vom städtischen Bürgertum geförderte Bürgerspital seit dem 13.Jahrhundert. Das Spital lag bis zu seiner Zerstörung während der ersten osmanischen Belagerung von 1529 vor den Stadttoren und wurde später innerhalb dieser aufgebaut. Das Bürgerspital finanzierte sich über Spenden und wirtschaftliche Eigenaktivitäten. Armut wurde bis Ende des 18.Jahrhunderts nicht unbedingt als persönliche Schuld gesehen und deren Bekämpfung fiel unter religiöse Verpflichtung. Mit Beginn des 19.Jahrhunderts begannen aber die Kämpfe für die Errichtung eines staatlichen Wohlfahrtssystem, das auch nach Ende des Ersten Weltkriegs eingeführt wurde. Seitdem existieren staatliche gesetzlich festgelegte Unterstützung für Arbeitslose und Hilfsbedürftige. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses System in der uns heute bekannten Form weiter ausgebaut. Mit den Wirtschaftskrisen Beginn der 1980er Jahre wurde aber verstärkt auf die aktive Arbeitsmarktpolitik gesetzt. Dies hieß Arbeitslosen und anderen Bezugsberechtigten die Möglichkeit für Weiterbildung und Eigeninitiativen zu anzubieten. Eines dieser Projekte ist der „Würfel“, der Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit gibt, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein weiterer Schritt ist die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, dessen Ausformung und Wirksamkeit im Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskurse steht. Der Ort: Das Wiener Bürgerspital wurde Mitte des 13.Jahrhunderts außerhalb der Stadtmauern vor dem Kärtner Tor errichtet. Nachdem es 1529 während der ersten osmanischen Belagerung zerstört wurde, wurde es innerhalb der Stadtmauern am Lobkowitz-Platz neu errichtet. Das ursprüngliche Gebäude befand sich ungefähr auf der Fläche, wo jetzt das Künstlerhaus und der Wiener Musikverein stehen. Die Gäste: Dr. Sarah Pichlkastner ist Historikerin und Kuratorin am Wien Museum. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Geschichte der institutionellen Fürsorge und Stadtgeschichte der Frühen Neuzeit Andreas Thienel ist Obmann bei „Der Würfel - Verein zur Unterstützung von arbeits-und erwerbslosen Menschen“ und war jahrelanger Mitarbeiter bei der Caritas Mag. Winfried Göschl ist Landesgeschäftsführer des AMS Wien und ausgewiesener Fachmann für Arbeitsmarktpolitik…
Proletarisches Fernsehen in Wien Der Inhalt: Von 1975 bis 1979 produzierte der Österreichische Rundfunk die Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“, zunächst als Adaption des Romans „Salz der Erde“ von Ernst Hinterberger (1966). Unerhört waren die explizite Sprache und die implizite Gewalt. Heikle Themen wie Rassismus, NS-Vergangenheit oder Geschlechterverhältnisse wurden dabei angesprochen. Das sorgte für hitzige Debatten. Auch die berühmte Sylvesterfolge thematisiert die Wehrmachtszeit der Figuren. Zugleich wurde die Serie immer populärer und mit zunehmender zeitlicher Distanz wurden Stoff und Figuren verklärt. Edmund „Mundl“ Sackbauer war ursprünglich ein vielschichter, auch düsterer Charakter. Heute steht er vielfach für den Ur-Wiener, der mit Grant und Schmäh durchs Leben geht. Der Ort: Die Hasengasse befindet sich im 10. Wiener Gemeindebezirk, in Favoriten. Sie steht hier für das „ursprüngliche Favoriten“, das zur Zeit der Produktion der Serie schon im Verschwinden war. Benannt wurde sie 1862 nach den bis dato stattfindenden Hasenjagden am „Hasenfeld“. Sie verläuft parallel zur Gudrunstraße. „Ein echter Wiener geht nicht unter“ spielt zwar in dieser Gasse, was ihr einige Bekanntheit auch über Wien hinaus gebracht hat, jedoch wurde die Serie gar nicht dort sondern in Wien West sowie den Rosenhügelstudios gedreht. Der Gast: Florian Wagner studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Ein Fachgebiet ist Zeitgeschichte und Medien. Hier untersuchte er die Darstellung historischer Transformationsprozesse in den Fernsehserien „Ein echter Wiener geht nicht unter“ und „Kaisermühlen Blues“. Florian Wagner arbeitet im Haus der Geschichte Österreichs.…
Habsburgs Hausheiliger im Dienst gegen Reformation und Aufklärung Der Ort: Am Betonbrückenpfeiler der Bahnhofs Stadlau im 22.Bezirk befindet sich eine von Werner Feiersinger gefertigte künstlerische Stahlkonstruktion, die die Gestalt des Heilige Nepomuk darstellt. Die Arbeit wurde 2010 angebracht und ist ein Verweis auf die Schutzfunktion für Brücken dieses christlichen Märtyrers aus dem 14.Jahrhundert. Nach dem Abklingen des boomenden Nepomuk-Kults im 18. und 19.Jahrhundert, stellt diese neuere Arbeit eine auffällige Besonderheit dar. Der Inhalt: Nepomuk war ein kirchlicher Würdenträger im Prag des 14.Jahrhundert, der nach einem Streit zwischen König Wenzel und dem Erzbischof von Prag als Bauernopfer in der Moldau von der säkularen Staatsmacht in der Moldau ertränkt wurde. Im Zuge des 18.Jahrhunderts wurde der katholische Kult um den Heiligen Nikolaus sukzessive durch den des Heiligen Nepomuks abgelöst. Während zuvor an Brücken und Gewässern Statuen von Nikolaus zum Schutz aufgestellt wurden, wurden danach zu Ehren des böhmischen Nepomuks zahlreiche Kapellen und Kirchen errichtet. Das Herrscherhaus Habsburg machte sich den Kult um den Heiligen, der vor allem bei den niedrigen Ständen in Böhmen und Mähren beliebt war, für politische Zwecke zu Nutzen. Schon Karl VI nützte die allgemeine Popularität dieses Märtyrers, und seine Tochter Maria-Theresia versuchte im Zuge des österreichischen Erbfolgekrieges die nördlichen Erblande durch besondere Pflege des Andenkens an Nepomuk diese an sich zu binden. Der Kult nahm zum Teil solche Ausmaße an, dass ihn Joseph II zeitweilig verbot. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Nepomuk zahlreiche Statuen und Kapellen gewidmet. Vor allem die Orden der Zisterzienser und Jesuiten pflegten den Kult. Die Jesuiten nahmen damit insbesondere Bezug auf die Funktion Nepomuks als Beichtvater, da sie bis Mitte des 18.Jahrhunderts traditionell die Beichte der Mitglieder des Hauses Habsburg abgenommen haben. Die Verehrung war aber auch ein lukratives Geschäft, da eine Vielzahl von Künstlern für die Produktion von Statuen und Abbildungen beauftragt wurden. Der Heilige Nikolaus erlebte erst wieder eine Renaissance mit dem Weihnachtsmann, dessen Erscheinung mit dem spendierfreudigen kleinasiatischen Bischof aus dem 4.Jahrhundert n.u.Z. assoziiert wurde. Das Andenken hingegen an Nepomuk verschwand im öffentlichen Bewusstsein immer mehr. Nur mehr die wenigsten wissen über die Hintergründe dieses Heiligen, der vor allem zu Zwecke der Gegenreformation gegen die evangelische Kirche verwendet wurde, Bescheid. Der Gast: Mag.Christian Stadelmann ist Ethnologe, Kulturwissenschafter und Kustos am Technischen Museum Wien für den Sammlungsbereich „Alltag“. Nebenbei beschäftigt er sich vor allem mit religiösen Motiven in der Alltagskultur. Tipps und Tricks: Zum Lesen: Werner Telesko, Stefanie Linsboth, Sabine Miesgang: Verehrung des hl. Johannes von Nepomuk in Ostösterreich. Der Heiligenkult im Spannungsfeld von Frömmigkeitspraxis und Medialisierung. Zum Gratis-Download: https://land-noe.at/noe/stuf78.html Thomas Hauschild: Weihnachtsmann. Die wahre Geschichte. 2016 Zum Schauen: Jake Kasdan: Red One-Alarmstufe Weihnachten. 2024…
Erdöl- und Ergasgewinnung im Wiener Becken Der Ort: Im Weinviertler Gebiet Zistersdorf-Matzen-Neusiedl befindet sich das größte Erdöl- und Erdgasfeld Mitteleuropas. Das Vorkommen reicht bis in die Slowakei und ist ein Resultat von organischen Ablagerungen eines verschwundenen Meeres, welches vor mehreren Millionen Jahren die Grundlage für die Entstehung des Feldes legte. Zahlreiche Bohrungen heben diesen Rohstoff, wobei die tiefste 8.5 km in den Boden reicht. Die Gemeinde Zistersdorf, Matzen und Gösting wurden mit den 1930er Jahren zum „Texas“ von Österreich und machten sie zeitweise zu vergleichsweise wohlhabenden Gemeinden. Der Inhalt: Nachdem die galizischen Ölfelder während des Ersten Weltkriegs rasch verloren gingen, musste die Militärverwaltung den kriegswichtigen Rohstoff wo anders gewinnen. Erste Bohrungen im Weinviertel waren zwar erfolgreich, die Ausbeute war jedoch unrentabel. Erst ab den 1930 konnten ergiebige Felder erschlossen werden und einen ersten Erdöl-Boom auslösen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Bohrungen rasch von deutschen Firmen übernommen, da diese sie vor allem für militärische Bedürfnisse ausbeuteten. Nach dem Krieg fielen sie die Anlagen zuerst an die Sowjets, da sie als ehemaliges deutsches Eigentum zu Reparationszahlungen herangezogen wurden. Dieser Umstand beschleunigte die Umsetzung des Gesetzes der Verstaatlichung der Schlüsselindustrien, um diese dem Zugriff der Alliierten zu entziehen. Öl wurde noch bis 1961 an die UdSSR geliefert. Sowohl während der sowjetischen Verwaltung, wie auch danach waren Arbeitsplätze in der Ölindustrie beliebt, da sie hohe Löhne zahlte und zahlreiche Sozialleistungen bot. Die von den Sowjets verwalteten Öl-Betriebe waren auch die ersten in Österreich, die vertraglich gleiche Löhne für Männer und Frauen garantierten. Nach wie vor spielen die Vorkommen im Weinviertel für die österreichische Energieversorgung eine nicht unerhebliche Rolle, da ungefähr 7-8% des Gesamtbedarfs an Erdöl und 6% an Erdgas Österreichs gedeckt werden können. Der Gast: Mag. Andreas Vormaier ist Geowissenschafter und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Erdölgewinnung Österreichs in Vergangenheit und Gegenwart. Gegenwärtig arbeitet er als Lektor in einem wissenschaftlichen Verlag. Tipps und Tricks: Zum Lesen: Gerhard Ruthammer: Öldorado Weinviertel. Zur Geschichte des Erdöls im Weinviertel. 2013. Zum Runterladen: Österreichisches Montanhandbuch 2023. Herausgegeben vom BM für Finanzen: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bmf.gv.at/ dam/jcr:4abaabea-0c4b-4600-9415-939756f0a79a/MontanHandBuch %25202023.pdf&ved=2ahUKEwiOs8ncpYGKAxW2zwIHHe2IAPcQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw1Tr3F- w0IMQrLbJffVkdYJ Zum Besuchen: Erdöl Lehrpfad Prottes: http://www.prottes.at/Freizeit_Vereine/Tourismus/Sehenswertes/Erdoel- Erdgaslehrpfad Erdölmuseum Hodonin (Tschechien): https://www.areaacz.eu/museums/dein-place-to-be/museumsmap/museum-fuer-erdoelfoerderung- und-geologie-in-hodonin/ Erdölmuseum Zalaegerszeg: http://www.olajmuzeum.hu/…
1 Der Hackler unter den Heiligen 22:43
22:43  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut22:43
Plăcut22:43
Modernistischer Kirchenneubau im Austrofaschismus Der Ort: Am Pius-Barsch-Platz 3 in Floridsdorf wurde 1936-1938 ein Kirchenneubau nach Plänen von Robert Kramreiter errichtet. Das Gebäude wurde mit Bedacht in der Nähe der großen Gemeindebauten in Floridsdorf errichtet, da auch hier u.a. die schwersten Kämpfe Februar 1934 stattfanden. Die Benennung der Kirche nach dem Heiligen Josef als Schutzpatron der ArbeiterInnen und der explizite Verweis auf die 12 Apostel als Symbole eines bescheidenen Urchristentums waren auch als Versöhnungsangebot an die lokale Bevölkerung gedacht. Der Inhalt: Nach Beseitigung der parlamentarischen Demokratie 1933 durch die Christlich-Soziale Partei konnte die nun neu eingerichtete Vaterländische Front auch im staatlichen Bauwesen nach ihrem Gutdünken vorgehen. Dabei setzte sie vor allem auf zwei Schwerpunkte. Einerseits sollte in Anlehnung an das italienische faschistische Regime vor allem in Infrastrukturprojekte wie Brücken und Straßen investiert werden. Andererseits versuchte man im Zuge der engen Verzahnung von austrofaschistischem Staat und Kirche vermehrt neue Gotteshäuser zu errichten. Diese wurden in der Nähe zu traditionellen ArbeiterInnenquartieren und durchaus im modernen architektonischen Stil gebaut. Als Schutzpatron dieser neuen Kirchen bot sich vor allem der Heilige Josef als biblischer Tischler (und somit Arbeiter) und verständnisvolle Vaterfigur besonders an. Auch wurde dieser Prozess von einer theologischen Orientierung auf die Jesus-Verehrung und auf eine Art Urchristentum begleitet. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden diese Maßnahmen radikal beendet. Die Tipps: Zum Lesen: Andreas Suttner: Das schwarze Wien. Bautätigkeit im Ständestaat 1934 bis 1938. Wien 2017 Alfred Pfoser, Béla Ráski, Hermann Schlösser: Maskeraden. Eine Kulturgeschichte des Austrofaschismus. Wien 2024 Jan Tabor: Kunst und Diktatur. Architektur, Bildhauerei, Malerei in Österreich, Deutschland, Italien, Sowjetunion 1922 bis 1956. Katalog Wien 1994…
Die Eroberung der Nacht Der Ort: In der Neubadgasse 6 im Ersten Wiener Bezirk befand sich das erste Elektrizitätswerk Wiens. Das 1889 eröffnete Kraftwerk erzeugte Strom durch Verfeuerung von Kohle und belieferte vor allem wohlhabende und fortschrittsorientiere adelige und bürgerliche Haushalte in unmittelbarer Umgebung. Die geringe Leistung und die große Nachfrage an Elektrizität machten den Betrieb des Kraftwerks bald unrentabel. Heute befindet sich dort die Umspannzentrale der Wien Energie an diesem Platz. Der Inhalt: Die Elektrifizierung der Wiener Haushalte nahm ab den 1890er Jahren rasant an Fahrt zu. Nach der Weltausstellung von 1873 und weiteren Leistungsschauen wurde Strom als Symbol für Fortschritt, Sicherheit und komfortablen Wohngenuss gehandelt. Vor der Elektrifizierung wurden die Wiener Haushalte vor allem durch Petroleumlampen, Gas- und Öllichter beleuchtet. Die Katastrophe des Ringtheaterbrands von 1881 gab der Umstellung von Gas auf Strom in Beleuchtungsfragen den entscheidenden Impuls. Wien stellte aber international eine Ausnahme dar, da es parallel ein großes Gasnetz für Beheizung und ein weiteres Stromnetz für Beleuchtung und Antrieb von Maschinen bis heute unterhält. Anfänglich wurden aber nur wohlhabende Wohnquartiere mit Strom versorgt, da dieser im Vergleich mit Gas teuer war. Mit dem Zusammenbruch der Monarchie und dem Wegfall der Kohlereviere in Böhmen und Schlesien verteuerte sich auch der Gaspreis enorm, da das sogenannte Stadtgas aus Kohle gewonnen wurde. Dieser Umstand und Sicherheitsdebatten führten dazu, dass das Stromnetz in Wien sukzessive ausgebaut und marketingtechnisch beworben wurde. Der Eingang von elektrisch betriebenen Haushaltsmaschinen fand anfangs auch schleppend statt, da diese teuer und von Dienstboten betrieben werden mussten. Daher wurde die Elektrifizierung der Haushalte auch immer von sozial-politischen und technischen Experimenten begleitet. Der Gast: Christian Stadelmann ist Kulturwissenschafter und Kustos für den Bereich „Alltag“ im Technischen Museum Wien. Dort betreut er unter anderem die Sammlung Haushaltsgeräte und städtische Infrastruktur.…
Österreichs Hauptstadt der Toten Der Ort: Der Zentralfriedhof ist der zweitgrößte Friedhof Europas und umfasst mehr als 2,3km². Als man in den 1860er Jahren einen Ort für eine große zentrale Bestattungsstelle suchte, wurde das Areal in Simmering nicht zufällig ausgewählt. Es sollte außerhalb der Stadt liegen aber verkehrstechnisch erschließbar sein. Wichtig war bei der Entscheidung, dass der Boden wichtige Bedingungen erfüllte: Ein hoher Lössanteil für die Gartengestaltung und als notwendige Voraussetzung für die rasche Verwesung der Leichen, eine tektonische Beschaffenheit, die eine toxische Gefährdung des Grundwassers verhindert und dass die Luftströme sich nicht zur Stadt bewegen. Seit seiner Eröffnung 1874 fanden hier mehr als 3 Millionen Menschen ihre letzte Ruhestätte. Der Inhalt: Friedhöfe innerhalb urbaner Siedlungsgebiete sind erst mit Aufkommen christlicher Beerdigungsrituale entstanden. Im Zuge der Aufklärung und zunehmender Bodenknappheit expandierender Städte im 18.Jahrhundert wurden die Rufe zur Verlegung der Friedhöfe außerhalb des Stadtgebietes lauter. Als aufgrund des rapiden Wachstums die Vorstadtfriedhöfe die Toten der Hauptstadt nicht mehr aufnehmen konnten und die Kirche inakzeptable Finanzforderungen hinsichtlich Bewirtschaftung der Gräber stellte, wurde 1863 im Gemeinderat der Bau eines großen zentralen kommunalen Friedhofs beschlossen. Der Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet und war ursprünglich als überkonfessioneller Friedhof geplant. Am Friedhof entzündeten sich aber bald politische, wissenschaftliche und kulturelle Debatten, die die jeweiligen zeithistorischen Diskurse widerspiegelten. Der „Zentral“ entwickelte sich über die Jahre auch zu einem Repräsentationsort der Ersten und Zweiten Republik und ist heute aufgrund seiner Diversität ein Spiegelbild gesellschaftlicher Veränderungen. Die Tipps: Zum Lesen: Werner T.Bauer: Wiener Friedhofsführer. Wien 2004 Zum Informieren und Verkosten: Faltpläne, Kaffeetassen und Friedhofsbienenhonig: https://shop.friedhoefewien.at/ Zum VorbereitenBestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof. Simmeringer Hauptstraße 234. Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr: 10.00-16.00. https://www.bestattungsmuseum.at/ Zum Einstimmen: Wolfgang Ambros: Es lebe der Zentralfriedhof. Bacillus Records. 1975…
Arbeit am Schwindel Der Inhalt: Die Berufsgruppe der Schausteller innen definiert sich über das Betreiben sogenannter Fahrgeschäfte. Heute kennt man sie vor allem als jene Personengruppe, die auf Kirtagen und Messen unterschiedliche Belustigungen (Karusselle, Autodrome, Schiffschaukeln, …) oder mobile Gastronomiebetriebe (Zuckerwatte, Süßigkeiten, …) betreiben. Über viele Jahrhunderte hatte aber diese Berufsgruppe noch viele andere Funktionen. Sie war nicht nur Versorgerin von wichtigen Güter für entlegene Ortschaften, sie bot ebenfalls medizinische oder Informationsdienste an bzw. organisierte populär-wissenschaftliche Schauen. Damit stand sie immer an der Schnittstelle von Handel, Unterhaltung, Information und Sensationslust. Wenig bekannt ist aber, wie die Schausteller innen über die Jahrhunderte ihr Leben und ihren Alltag organisiert haben und wie sich die heutige Generation dieser Gewerbetreibenden neuen Herausforderungen durch Digitalisierung und Globalisierung stellen. Der Ort: Der Ottakringer Kirtag findet seit den 1970er Jahren jedes Jahr am vorletzten Septemberwoche auf der Ottakringer Hauptstraße im 16.Bezirk statt. Auch auf diesem Kirtag, der mitten in einem proletarischen und migrantisch geprägten Bezirk stattfindet, bieten Schausteller*innen zahlreiche Fahrgeschäfte an. Der Gast: Veronika Barnaš ist Kulturwissenschafterin, Kuratorin und Filmemacherin. Gegenwärtig schreibt sie an ihrer Doktorarbeit zu den Arbeitsbedingungen von Schausteller*innen. Die Tipps: Zum Lesen: Florian Dering: „Volksbelustigungen. Eine bildreiche Kulturgeschichte von den Fahr-, Belustigungs- und Geschicklichkeitsgeschäften vom 18.Jahrhundert bis zur Gegenwart“. 1986 Sacha-Roger Szabo: Rausch und Rummel. Attraktionen auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks. Eine soziologische Kulturgeschichte. 2006 Zum Schauen: Kurzfilm „Fahren“ von Veronika Barnaš; Link: www.veronikabarnas.net…
Arterie durch den Stadtkörper Der Ort: Der Donaukanal ist einer der ehemaligen fünf großen Arme der an Wien vorbeifließenden Donau. Bis zur Donauregulierung 1870-75 und vor der Ausdehnungsbewegung der Stadt bis zum Hauptarm der Donau war der Kanal die wichtigste schiffbare Transportstraße. Der Kanal ist insgesamt 17.3km lang und weist eine Breite zwischen 50-70m auf. Der Inhalt: Lange Zeit war der heutige Donaukanal der Hauptarm zur Versorgung der Stadt für Güter, die per Schiff transportiert wurden. Das mittelalterliche Stapelrecht, welches die durchreisenden Kaufleute zwang, ihre Ware eine Zeitlang in Wien feilzubieten, machte die Hauptstadt zu einem wichtigen Handelszentrum. So siedelten sich entlang des Donauarmes zahlreiche Gewerbe- und Handwerksbetriebe an, die in direktem Zusammenhang mit den transportierten Gütern standen. Vor allem Holz-, Nahrungsmittel- und Speditionsbetriebe waren entlang des Kanals zu finden. So gab es um die Innere Stadt entlang des Kanals auch zahlreiche Märkte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Donaukanal immer wieder befestigt und reguliert, seine endgültige Form erhielt er im Zuge der Donauregulierung 1870-75 und den nachfolgenden Errichtungen von Schleusen und Kaimauern. Auf seiner ganzen Länge finden sich unterschiedlichste Nutzungen wieder: proletarische Massenquartiere, bürgerliche Prachtbauten, Verwaltungs- und Militäreinrichtungen, Industriebetriebe und Aulandschaften. Während des 2.Weltkriegs wurden große Teile des Kanals zerstört, seitdem steht das Gewässer immer wieder im Mittelpunkt stadtplanerischer Überlegungen. Gegenwärtig entwickelt er sich vor allem zu einem der wichtigsten Freizeit- und Erholungsgebiete im Stadtzentrum. Tipps und Tricks: Zum Lesen: Hermann Hetzmannseder, Andreas Belwe: Donaukanal. Eine Hommage. 2018. Heilfried Seemann, Christian Lunzer: Wiener Donaukanal 1880-1960. 2010. Zum Nachschauen: Online Sammlung Wien Museum: https://sammlung.wienmuseum.at/suche/?fullText=Donaukanal Zum Flanieren: Homepage von Anton Tantner: https://homepage.univie.ac.at/anton.tantner/ankuendigungen.html…
Die Wiener Rohrpost 1876-1956 Der Ort: Börsenplatz 1 Das Gebäude wurde 1873 errichtet und diente als Zentrale der k.k. Post und Telegrafenverwaltung. Ursprünglich ausschließlich für die Übersendung von Post- und Telegrafien gedacht wurde das Gebäude 1876 zum Hauptsitz für das Rohrpostwesen umgebaut. Symbolisch wurde am Haupttrakt eine um den Globus sitzende Figurengruppe mit dem Götterboten Hermes angebracht. Bis 1996 wurde das Gebäude von der Post als Verwaltungsgebäude genützt. Nach mehrerer Jahre Leerstand wurde es an einen Immobiliengruppe verkauft, die es zu einem der teuersten Wohnadressen unmittelbar hinter der Börse umbaute. Der Inhalt: Die Entwicklung des Rohrpostwesens in Wien Das moderne Finanz- und Verwaltungswesen, welches sich im 19.Jahrhundert im städtischen Raum etablierte, benötigte dringend ein Transportwesen, um Telegramme, Briefe oder kleinere Gegenstände sicher und schnell durch die Stadt transportieren zu können. Überfüllte Straßen und nicht ausgebaute Verkehrswege erschwerten die rasche Übersendung von wichtigen Nachrichten. Mit Beginn des 19.Jahrhunderts wurden Überlegungen angestellt, Briefe unterirdisch in Röhren zu transportieren. Der Durchbruch gelang aber erst mit der Entwicklung der Kompressoren Technik, die vor allem im Vorfeld von pneumatischen Transportsystemen zur Verfügung. Wien errichtete 1876 als einer der ersten europäischen Metropolen ein umfassendes Rohrpostsystem ein, in dem Nachrichten in metallischen Zylindern mit Hilfe von Druckluft durch ein weit verzweigtes Röhrensystem geschossen wurden. Das System war sogar so erfolgreich, dass man kurzzeitig über den Transport von Leichnamen in einem eigenen pneumatischen Transportsystem nachdachte. Am Höhepunkt der Rohrpost 1913 wurden mehr als 5 Millionen Sendungen vorgenommen. Mit der Zeit nahm die Bedeutung des Rohrpostsystem ab, 1956 wurde der offizielle Postbetrieb ganz eingestellt. Seitdem gibt es nur mehr in privatgeschäftlichen Zusammenhänge Rohrpostsysteme (Bibliotheken, Apotheken, Krankenhäusern,…).…
Der politische Liedermacher Sigi Maron Ort: Jesuitenwiese, Volksstimmefest Die im Wiener Prater liegende Jesuitenwiese war bis 1773 im Besitz des Ordens. Mit der unter Kaiser Josef II verordneten zwanghaften Auflösung des Jesuitenordens wurde die Wiese eingezogen und gleichsam verstaatlicht. Wurden schon in der Zwischenkriegszeit auf der Wiese Volksfeste gefeiert, zelebriert die ehemalige Tageszeitung der KPÖ seit 1946 einmal jährlich am ersten Septemberwochenende ein großes mehrtägiges Volksfest. Inhalt: Sigi Maron war einer der bekanntesten kritischen Liedermacher in Österreich. Geboren 1944 in Baden bei Wien infizierte er sich als Jugendlicher mit Kinderlähmung und war seitdem nur mit Hilfe eines Rollstuhls mobil. Maron engagierte sich schon früh politisch und richtete sein künstlerisches Schaffen auf soziale und emanzipatorisch Fragestellungen aus. Er engagierte sich u.a. in der Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung und war Mitglied der KPÖ, zu der immer auch ein kritisches und differenziertes Verhältnis hatte. Maron schrieb seine Liedtexte in Dialekt und gebrauchte oft eine sehr heftige und direkte Wortwahl. Er schrieb aber auch sanfte Liebesballaden und war auch literarisch aktiv. Lange Zeit wurde er aufgrund seines politischen Engagements im österreichischen Rundfunk nicht gespielt, erst in den 2000er Jahren wurde sein Werk auch einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert. Berühmt waren auch Marons legendäre Live-Auftritte, wie die in der Arena 1976 oder auf den diversen Volksstimme-Feste. Kaum ein anderer Künstler stand wie Sigi Maron für ein politischen und soziales Engagement, welches prägend für die österreichische Linke in den 1970er und 80er Jahre war. Maron verstarb 2016, heuer hätte er seinen achtzigsten Geburtstag gefeiert. Zum Lesen: Margit Niederhuber, Walter Gröbchen: Redn kam ma boid. Wien 2024 Christiane Fennesz-Juhasz: Kritische Lieder und Politikrock in Österreich. Eine analytische Studie. Wien 1995 Philipp Maurer: Danke. Man lebt. Kritische Lieder aus Wien 1968-83. Wien 1987 Zum Hören: Sigi Maron: San aufn Weg. CD 2017 Zum Schauen: Kätze Kratz: Atemnot. 1984…
Die lange Straße aus Sand Der Ort: Die Stadt Caorle ist einer wichtigsten Tourismuszentren der nördlichen Adria und weist eine über 2000 Jahre alte Geschichte auf. Die Siedlung geht bis auf Römerzeit zurück und war schon damals ein wichtiger Handels- und Fischereihafen. Seit dem Mittelalter befindet sich die Stadt im Einflussgebiet der mächtigen und unmittelbar benachbarten Republik Venedig. Dominierte bis in die 1950er Jahre die Agrarindustrie das Wirtschaftsleben, entwickelte sich seitdem der Tourismus als wichtiger Einkommensfaktor. Inhalt: Caorle ist seit den 1950er Jahren einer der beliebtesten Ferienorte für ÖsterreicherInnen. Dabei steht das Städtchen idealtypisch für eine ganze Reihe von Orten, die sich zwischen Caorle und Grado als Feriendomizile etablierten. Neben den beiden erwähnten Tourismuszentren stehen auch Bibione, Lignano und Jesolo für familiären sommerlichen Badeurlaub. Seit den 1950er Jahren entwickelten sich diese Städte und Dörfer zu Sehnsuchtsorte für viele ÖsterreicherInnen. Während das noble Grado schon in der Monarchie eine wichtige Rolle als Kur- und Erholungsort innehatte, wurde nun der Küstenstreifen von Jesolo bis Lignano zum beliebten Ferienziel. Maßgeblich spielte dabei der Ausbau der Straßeninfrastruktur (Autobahnen) und der enorme Anstieg des motorisierten Individualverkehrs eine tragende Rolle. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Wirtschaftswunders auch für viele proletarische und kleinbürgerliche Familien der Strandurlaub im sonnigen Italien leistbar. Verdrängt wurde der klassische Bildungsurlaub durch den Erlebnistourismus. Statt Ruinenbesichtigung stand nun das günstige „Dolce far niente“, Sandburgenbau und in der Sonne braten im Vordergrund. Am Höhepunkt kamen über 9 Millionen TouristInnen pro Jahr in diese Orte, im Zuge der Änderungen der Tourismusströme sind es nun „nur“ mehr 6 Millionen. Mit den 1960er gerieten die Orte oft in Verruf als typische „Hausmeisterstrände“, für Reisende mit Distinguierungswunsch wurden seitdem exotischere Urlaubsziele attraktiver. Gerade Lignano kämpft in den letzten Jahren auch gegen einen Ballermann-Tourismus, der vor allem durch vergnügungssüchtige junge KurzurlauberInnen aus Österreich und Süddeutschland hervorgerufen wird. Tipps: Zum Lesen: Pier Paolo Pasolini: Die lange Straße aus Sand. Italien zwischen Armut und Dolce Vita. Hamburg 2023 Ernest Hemingway: Über den Fluss und in die Wälder. Hamburg 2010 Fernand Braudel: Die Welt des Mittelmeers. Hamburg 2006 Zum Schauen: Arte Dokumentation: Eine lange Straße aus Sand. Pier Pasolinis Reisen durch Italien. (2018) Heinz Erhardt: Das kann doch unsren Willi nicht erschüttern. (1970)…
Wiens Adria oder tiefste Badewanne? Der Ort: Der Neusiedler See gehört zu den größten Steppenseen Europas, welcher überwiegend von Regenund Grundwasser gespeist wird. Das 320km² große Gewässer besitzt keinen natürlichen Abfluss und nur zwei kaum nennenswerte Zuflüsse. Geologisch entstand es erst vor ungefähr 13.000 Jahren. Die Theorie, dass der See das Überbleibsel eines urzeitlichen Meeres sei, wurde spät widerlegt. Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften zeigt sich der See in seiner Form als instabil. So neigt er immer wieder zu Überflutungen und Überschwemmungen, aber auch zum zwischenzeitlichen Austrocknen. Der berühmte Schilfgürtel entstand erst durch Eintrag von Dünger durch die umliegende Landwirtschaft. Das Thema: Der Neusiedler See wurde spät als großer „Badeteich“ der Wiener innen erschlossen. Nachdem das Burgenland erst 1921 an Österreich fiel, wurde das Gebiet zögerlich touristisch erschlossen. Ab Mitte der 1920er Jahre wurden erste Badeanstalten am See eingerichtet - der Werbeslogan, der den Neusiedler See als „Adria der Wiener“ titulierte, war geboren. Hauptproblem stellte die verkehrstechnische Erschließung dar. Das Burgenland war infrastrukturell unterentwickelt, Bahn- und Straßenverbindungen waren spärlich. Die Überlegung der Einrichtung einer Schnellschwebebahn zwischen Wien-Mitte und Rust musste aufgrund der Wirtschaftskrise Ende der 1920er abgebrochen werden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Burgenland als Tourismusland. Dabei bediente man die Klischees des gesetzten, genießerischen Südens mit ungarischem Puszta-Flair im Gegensatz zum alpinen reschen Bergimage. Erst mit der Motorisierung breiterer Bevölkerungsschichten mit Hilfe der boomenden Automobilindustrie wurde der Neusiedler See für viele Ostösterreicher innen attraktiv. In den 1960er gab es sogar weitgediehene Pläne für die Errichtung einer mehrspurigen Autobahn quer über das Gewässer. Dieses Bauvorhaben wurde von der ersten breiten ökologischen Protestbewegung in Österreich Anfang der 1970er Jahre verhindert. Aber nicht nur aufgrund seiner ökologischen Eigenschaften ist der See einzigartig, auch wegen seiner Eigentumsverhältnisse. Der See gehört zu 44% einer einzigen Familie, nämlich dem Adelsgeschlecht der Esterházys. Nach wie vor erfreut sich die Adria der Wiener großer Beliebtheit, da sie nicht nur hohe Wassertemperaturen, sondern auch ideale Segel- und Sportmöglichkeiten aufweist und auf kurzem Weg für den Tagestourismus erreichbar ist.…
Gelsen, Nackerte und „Giftler“ Ort: Die Wiener Lobau ist größeren Teils Landschafts- und zum kleineren Naturschutzgebiet. Mit insgesamt 22km² stellt es für eine Metropole in der Größe Wiens eine ökologische Ausnahme dar, da sich in keiner anderen europäischen Hauptstadt unmittelbar ein Naturschutzgebiet befindet. Die Auenlandschaft dehnt sich vom Osten Wiens bis zur March an der slowakischen Grenze aus und stellt einer der wichtigsten Tier- und Pflanzenreservate Mitteleuropas dar. Inhalt: Aufgrund des Status der Lobau als Landschaftsschutzgebietes ist es nur an wenigen Stellen erlaubt zu Baden. So ist nur am Mühlwasser, dem Schillerwasser, der Panozza- und der Dechantlacke das Schwimmen gestattet. Erst mit der Donauregulierung 1870-75 konnte die Lobau als Naherholungsgebiet genützt werden, da zuvor der permanent sich verändernde Donaustrom für unsichere Verhältnisse sorgte. Die vielen Wasserarme und schwer zugänglichen Stellen machten die Lobau anfangs nur eingefleischte Naturliebhaber innen und Einsiedler interessant. Ab den 1920er Jahren entdeckte die in Mode gekommene Nudist innenbewegung die Lobau für sich. Gerade die oben genannten Eigenschaften machten das Gebiet für diese Gruppe interessant. Die Anhänger innen der sogenannten Lichtkultur waren vor allem in den politischen exponierten Lagern stark vertreten. Besonders die linke Arbeiter innenbewegung aber auch rechte völkisch orientierte Parteien standen der FKK aufgeschlossen gegenüber. Keine Anerkennung fand sie hingegen im bürgerlichen christlichen Lager, während des Austrofaschismus wurden Nacktbadende in der Lobau sogar mit berittener Polizei verfolgt, verprügelt und zu empfindlichen Strafen verurteilt. Während des Nationalsozialismus wurde Anfangs die FKK-Bewegung kritisch als möglich marxistisch infiltriert beobachtet. Im Zuge der Gleichschaltung der offiziellen Vereine sahen die Nazis in der Lichtkultur keinen Widerspruch mehr zu ihrer aberwitzigen Körper- und „Zuchtwahl“-Politik. Nach dem Zweiten Weltkrieg entspannte sich aufgrund der gesellschaftlichen Liberalisierung das Verhältnis zur Nacktheit. Das Nacktbaden in der Lobau war kein Politikum mehr, weder im Sinne einer moralischen Entrüstung noch eines reformerischen Politikverständnisses. Die Lobau blieb aber aufgrund seiner vielen Rückzugsorte ein Ort einer anderen illegalen Szene, nämlich der der Cannabisund Haschischkonsument innen. Vor allem in den 1970ern bekam die Au durch die Verschmelzung der Konsument innen von weichen Drogen und der Freund*innen der FKK einen hippiesken Anstrich. Mit der Zuteilung von FKK-Stränden an der Neuen Donau verlor die Lobau auch die Bedeutung fürs Nacktbaden.…
Körperertüchtigung & Arbeiter*innenolympiade Ort: Das Stadionbad liegt im 2. Bezirk in unmittelbarer Nähe zum Wiener Praterstadion. Das Bad gehört zu den größten Freibädern Europas und kann bis zu 6500 badende Gäste aufnehmen. Die Anlage dient unter anderem auch zur Ausrichtung sportlicher Wettkämpfe, es besitzt als eines der wenigen Bäder ein wettkampftaugliches Schwimmbecken, einen Springturm und dazugehörige Arenaplätze. Nebenbei erfreut es sich auch großer Beliebtheit aufgrund seiner ausgedehnten, beschatteten Wiesenplätze und des Wellenbeckens. Inhalt: Unmittelbaren nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte die sozialdemokratische Stadtregierung Konzepte hinsichtlich der Errichtung eines großen Sport- und Freizeitkomplexes, in der neben Breitensportarten auch sportliche Wettkämpfe bestritten werden können. Dabei nahm man vor allem Maß an den Sportparks in Frankfurt und Nürnberg, aber auch Anleihen aus den Bauvorhaben der noch jungen Sowjetunion. Als Ort dieses Parks wurde zuerst an die Bezirke Ottakring bzw. im Fasangarten Schönbrunn gedacht, aber aufgrund unterschiedlicher Gründe fiel die Entscheidung auf den Wiener Prater. Nach kurzer Planungs- und Bauphase wurde 1931 das Stadionbad im Zuge der 2. Arbeiterolympiade, an der 25.000 Menschen teilnahmen, gemeinsam mit dem Praterstadion eröffnet. Das Bad lag in unmittelbarer Nähe zum jüdischen Sportverein Hakoah. Im Zuge der politischen Auseinandersetzungen in der Zwischenkriegszeit kam es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen jüdischen Wassersportlern und national-faschistischen Anhängern vor Ort. Während des Krieges wurde das Bad zerstört und unmittelbar nach dem Krieg rasch im erheblichen Maß vergrößert aufgebaut. Die rasche Wiederherstellung der Wiener Großbäder nach dem Krieg weist auf den außerordentlich wichtigen Stellenwert der Bade- und Freilichtkultur in den Überlegungen der Wiener Sozialdemokratie in Bezug auf Gesundheits- und Freizeitkultur hin.…
Kabanen, Mohneis und FKK Ort: Das Wiener Gänsehäufel im 22.Bezirk ist einer der größten europäischen Freibäder im städtischen Bereich. Das Areal umfasst mehr als 33 ha und bietet 65.000m² Wasserfläche. Das gesamte Areal ist über einen Kilometer lang und bis zu 500m breit. Das Bad ist eigentlich eine Insel, die nur über eine Brücke zu betreten ist. Bis zum Ende des 1.Weltkriegs war das Bad nur schwimmend oder mit Booten erreichbar. Insgesamt weist das Areal einen Bestand von mehr als 2.200 Bäume auf. Das Gänsehäufel wurde als erstes Wiener Bad mit einem Wellenbad ausgestattet und bietet weitere zahlreiche Sportmöglichkeiten. Seit 1981 existiert auch ein reservierter Bereich für die Anhänger*innen der Freikörperkultur (Nackbaden). Inhalt: Das 1907 gegründete Freibad Gänsehäufel ging auf die Initiative des Reformheilkundlers und Naturfreundes Florian Berndl zurück. Das Gänsehäufel ist eine nach der Donauregulierung von 1875 im ehemaligen Hauptstrom entstandene Insel, die zuvor zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt wurde. Berndl richtete dort eines der ersten Freibäder in einer europäischen Metropole ein, in der sowohl Männer wie Frauen gemeinsam baden durften. Das Bad erhielt vor allem in liberalen bürgerlichen Schichten so großen Zuspruch, dass die konservative Stadtverwaltung unter der Leitung von Karl Lueger diesem für sie suspekten Treiben ein Ende setzen wollte. Berndl wurde in Folge die Pacht unter fadenscheinigen Gründen entzogen und das Gänsehäufel wurde ein kommunal verwaltetes Freibad. Die Errichtung der Einrichtung fiel in eine Epoche einer umfassenden, größtenteils bürgerlichen Reformbewegung, die von einem differenzierten Körperbewusstsein bis zur Neubewertung von Sexualität reichte. Nach dem Ersten Weltkrieg zog es vor allem auch Proletarier innen ins Bad, das Gänsehäufel entwickelte sich seitdem zum sprichwörtlichen „Lido“ der Wiener innen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden große Teile des Bades zerstört, der rasche Wiederaufbau erfolgte architektonisch im Stil der Neuen Sachlichkeit, die bewusst Abstand zum großsprecherischen faschistischen Baukitsch, aber auch zu einem vorgeblich revolutionären Zwischenkriegspathos nahm. An heißen Tagen baden dort bis zu 20.000 Menschen. Das Bad stellt einen eigenen Mikrokosmos mit Restaurants, Sportanlagen und sogar einem Kasperltheater für Kinder dar.…
Von der "Pissrinne" zum Freizeitparadies Ort: Die Donauinsel wurde zwischen 1972 und 1988 auf insgesamt 21,1km Länge quer durch die Stadt parallel zur Donau gelegt. Mit der Schaffung einer künstlichen Insel setzte man städtebaulich neue Maßstäbe: So weist die Donauinsel insgesamt 380 ha hochwasserfreie Fläche auf, zusätzlich wurden 330ha Wasserfläche für die Öffentlichkeit bereitgestellt. Insgesamt wurden 135km Wege errichtet und für die Begrünung 1.8 Millionen Bäume und Sträucher gepflanzt sowie 170ha Wald angelegt. Berühmt wurde die Donauinsel auch mit dem jährlich stattfindenden Donauinselfest, einer der größten Freiluft Veranstaltungen weltweit, mit über 3 Millionen BesucherInnen an dem Veranstaltungswochenende. Inhalt: Mit der Donauregulierung 1870-75 glaubte man den verheerenden Hochwassern der Donau im Wiener Raum ein Ende gesetzt zu haben. Jedoch musste man nach dem durch einen Eisstoß verursachten Hochwasser von 1954 erkennen, dass die Dämme und das Überschwemmungsgebiet für Jahrhunderthochwasser keinen ausreichenden Schutz boten. Nach langen Diskussionen über unterschiedliche Lösungsansätze beschloss die Stadtregierung den Bau des sogenannten Entlastungsgerinne parallel zur Donau. Was am Anfang nur als schnurgerader Damm mit steiler Böschung und möglicher Bebauung auf dem Damm gedacht war, entwickelte sich aufgrund der beharrlichen Interventionen von Raum- und Städteplaner zum heutigen Freizeitpark und Grünstreifen mitten in der Stadt. Aber auch gesellschaftspolitische und soziale Veränderungen nahmen maßgeblich Einfluss auf die heutige Form. Eine neue Freizeitkultur entstand als Folge der Arbeitszeitverkürzung, aber auch der Wunsch nach Erholungsgebieten im unmittelbaren Umfeld, um den explodierenden motorgestützten Individualverkehr einzudämmen. Tipps: Zum Lesen: Leopold Redl, Hans Wösendorfer: Die Donauinsel. Ein Beispiel politischer Planung in Wien. Wien 1980 Zum Anschauen: Youtube Videokanal von Bernhard Rennhofer: Die größte Baustelle in der Geschichte von Wien. So wurde die Donauinsel in Wien gebaut. https://www.youtube.com/watch?v=EVe1byxe6GY Zum Mitfeiern: Falco Konzert auf der Donauinsel 1993. Auf Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=bqseW3ZItxA…
Orte des Queeren Wien im 20. Jhdt Ort: Das Kaiserbründlbad in der Weihburggasse 18-20 im Ersten Wiener Bezirk wurde 1889 gegründet. Am Anfang hieß es Central-Bad und war von Anfang an als exklusives Bad mit Wellness-Bereich angelegt. Das Bad zeichnet sich durch seine im orientalischen Stil gehaltene Einrichtung aus und fungiert heute als Herren- bzw. Gaysauna. Inhalt: 1905 ereignete sich in der Wiener Gesellschaft ein Skandal, in dem der leibliche Bruder des Kaisers Franz-Josef, der Erzherzog Ludwig Viktor, angeblich einen Mann im damaligen Centralbad Avancen gemacht hätte und dieser ihn darauf ohrfeigte. Ludwig Viktor wurde endgültig vom Hof verbannt und musste ins gesellschaftliche Exil nach Salzburg ziehen. In der konservativen Hauptstadt gab es kaum Plätze oder Orte, an den sich queere Menschen treffen oder Kontakte schließen konnten, ohne sanktioniert zu werden. Der berüchtigte Paragraph 129lB stellte Homosexualität unter Strafe. Bis zu seiner Abschaffung 1971 wurden tausende Homosexuelle verurteilt und diskriminiert, besonders schlimm war die Verfolgung während des Nationalsozialismus. Um ein Mindestmaß an sozialem Leben zu ermöglichen, mussten sich Schwule und Lesben besonders gut versteckte oder getarnte Orte schaffen. Cafés, Schwimmbäder oder öffentliche Bedürfnisanstalten waren oft die einzigen Plätze, an denen man Menschen mit gleicher sexueller Orientierung treffen konnte. Wie diese Orte aussahen und wo sie sich befanden, handelt diese Folge der Geschichtsgreißlerei. Gast: Andreas Brunner ist Kulturwissenschafter, Autor, City-Guide und Aktivist. Er leitet auch das Forschungszentrum QWIEN. Tipps: Zum Lesen: Andreas Brunner: Als homosexuell verfolgt: Wiener Biografien aus der NS-Zeit. Wien 2023 Zum Abgehen: Queere Stadtführungen. Veranstaltet durch QWIEN. Buchungen unter: https://www.qwien.at/queere-stadtfuehrungen-queere-spezialfuehrungen/ Zum Anschauen: Theaterstück: Luziwuzi. Ich bin die Kaiserin. Aufführungen im Rabenhoftheater. https://www.rabenhoftheater.com/programm/luziwuzi…
Vom internationalsten Flughafen der Welt zur Boomtown Ort: Das Flugfeld Aspern befand sich auf dem heutigen Areal der Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk. Bis zum Vollausbau 2028 sollen auf dem ehemaligen Flugfeld auf insgesamt 240 Hektar mehr als 25.000 Menschen wohnen und 20.000 arbeiten. Das Areal gehört zu den wichtigsten gegenwärtigen Wohnbauprojekten der Stadt Wien und ist mit insgesamt 5.Mrd Euro Investitionsvolumen eines der größten in der Stadtgeschichte. Inhalt: 1912 wird auf Initiative mehrerer Fliegerklubs und Vereinen in Donaustadt ein Flugfeld im Nord-Osten von Wien errichtet. Österreich hatte schon damals eine beachtliche Flugzeug- und Fesselballonproduktion, die u.a. im Bezirk Donaustadt angesiedelt war. Schnell entwickelte sich das Flugfeld zur zentralen Anflugstelle für Flugzeuge und Zeppeline. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Aspern zu einem der wichtigsten europäischen Flughäfen, von dem zahlreiche Fluglinien west- und osteuropäische Destinationen anflogen. Während des 2.Weltkriegs wurde der Flughafen vor allem militärisch genützt, hier landete am 12.März 1938 schon frühmorgens die Spitze der SS um den österreichischen Polizeiapparat rasch unter Kontrolle zu bringen. Nach der Niederlage HitlerDeutschlands verlor das Flugfeld immer mehr an Bedeutung, Schwechat wurde in den 1950er Jahren zum internationalen Airport. Aspern diente seitdem vor allem für Sport- und Segelflieger. Das Flugfeld wurde zunehmend anders genützt, unter anderem als Auto-Rennstrecke. Spätere Formel 1 Weltmeister wie Jochen Rindt oder Niki Lauda fuhren dort Rennen. 1977 wurde das Gelände endgültig für den Flugverkehr gesperrt, danach wurde ein großes Autozuliefererwerk von General Motors bzw. Opel errichtet. Am Höhepunkt der Motorproduktion waren hier 2200 Menschen beschäftigt. Mit der Krise der Automobilindustrie wurde auch dieses Werk Anfang der 2020er endgültig geschlossen. Das Industriegelände wurde stückweise geschliffen und auf dem ehemaligen Gelände die Seestadt Aspern errichtet. Gast: Wolfgang Stritzinger ist Kustos am Technischen Museum Wien für Flug- und Schiffverkehr und ausgewiesener Experte für die Geschichte der österreichischen Zivilluftfahrt. Tipps: Zum Lesen: Reinhard Keimel: Aspern. Geschichte eines Flughafens Sutton Verlag, 2009 Thomas Ballhausen, Andrea Grill, Hanno Millesi : aspern. Reise in eine mögliche Stadt“. Wien 2013 Cornelia Dlabaja: Die Seestadt Aspern. Ein Stadtteil im Werden. Wien 2023…
Eine Geschichte des Vergnügens und seiner Schattenseiten Ort: Der Wiener Wurstelprater ist Teil des Praters und ist ungefähr 26ha groß (das sind 4% der Gesamtfläche des Praters). Mit mehr als 7 Millionen BesucherInnen jährlich gehört er zu den Hauptattraktionen des Wien-Tourismus. Der Wurstelprater ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Mehr als 80 Betriebe beschäftigen bis zu 2.700 Menschen und erwirtschaften Millionen-Umsätze. Der Wurstelprater wurde aber erst mit der Weltaustellung 1873 zu dem Vergnügungsort par excellence in Wien. Thema: Die Fahrgeschäfte im Wurstelprater wurden traditionell von dort tätigen einzelnen Familiendynastien betrieben. Mit der Weltausstellung 1873 entwickelte sich der Prater aus einem Konglomerat einzelner Buden zu einem professionellen Freizeitgelände. Restaurants, Hochschaubahnen, Geisterbahnen, Imbissbuden und Kinos waren die Hauptattraktionen, die unter anderem lukrative Einkommensquellen darstellten. Unter den BetreiberInnen befanden sich auch BürgerInnen, die mosaischen Glaubens waren bzw. denen eine jüdische Identität zugeschrieben wurden. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 begann sofort ein Gerangel von Mitgliedern der NSDAP, sich die Geschäfte jüdischer EigentümerInnen bzw. die als solche definiert wurden, anzueignen. Dabei taten sich vor allem sogenannte „ehemalige illegale Kämpfer“ oder deren Witwen hervor. Zum Teil waren die Methoden der österreichischen Nazis so unverschämt und rücksichtslos, dass die Berliner Zentrale, wenn auch nicht aus humanistischen Gründen, ordnend eingreifen musste. Die Gegenstrategien der Enteigneten waren manchmal hilflos, manchmal listig – aber am Ende zumeist erfolglos. Viele Attraktionen wie die Liliputbahn oder das Riesenrad gerieten in den Besitz von Nazis. Die Familien der ehemaligen BesitzerInnen wurden verhaftet, vertrieben oder über die ganze Welt verstreut. Und viele ließen in der Shoah auch ihr Leben. Nach dem Krieg wurden nur wenige Familien entschädigt, sie teilten das Schicksal vieler anderer rassistisch Verfolgter. Gast: Sarah Knoll ist Zeithistorikerin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Flucht und Migration, New Cold War Studies, Internationale Organisationen und NGO’s und ist ausgewiesene Fachfrau für die Geschichte des Wiener Praters. Tipps: Zum Lesen: Werner Michael Schwarz, Susanne Winkler: Der Wiener Prater. Ein Ort für alle. Wien 2024 Werner Michael Schwarz, Susanne Winkler: Der Wiener Prater. Labor der Moderne. Politik-Vergnügen-Technik. Wien 2024 Ursula Storch: In den Prater! Wiener Vergnügen seit 1776. Wien 2016 Stephan Templ, Tina Walzer: Unser Wien. Arisierung auf Österreichisch. Berlin 2001 Jutta Fuchshuber, Lukas Meissel: Aufregende Forschung. Zeitgeschichtliche Interventionen von Hans Safrian. Wien 2022 Zum Hingehen: Wiener Pratermuseum. Praterstraße 92 (Straße des 1.Mai), 1020 Wien. https://www.wienmuseum.at/pratermuseum Inventarnummer 1938. Ausstellung im Technischen Museum Wien, Mariahilfer Str.212, 1140 Wien. https://www.technischesmuseum.at/ausstellung/inventarnummer_1938…
1 Bis zur Adria reichte es leider nicht! 31:28
31:28  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut31:28
Plăcut31:28
Der Wiener Neustädter Kanal Der Ort: Der Wiener Neustädter Kanal erstreckte sich am Höhepunkt seiner Ausdehnung Mitte des 19.Jahrhunderts vom Wiener Stubentor bis nach Wiener Neustadt. Der damals 63km lange Kanal wurde von 2 Häfen eingefasst, nämlich einem in Wiener Neustadt und einem direkt am Wiener Stubentor bis zur damaligen Stadtmauer, wo sich heute der Schienenverkehrsknotenpunkt Wien Mitte befindet. Der Kanal führte über Wien Landstraße, Simmering, Maria Lanzersdorf, Laxenburg, Guntramsdorf, Baden bis Wiener Neustadt. Derzeit existiert dieser Wasserweg zwischen Guntramsdorf und Wiener Neustadt, die restlichen Teile wurden mit der Zeit zugeschüttet. Heute sind die noch bestehenden Teile beliebte Ausflugsziele für SpaziergängerInnen und RadfahrerInnen bzw. wird die ehemalige Verkehrsader für landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke genützt. Das Thema: Im Zuge der Industrialisierung Europas im 18.Jahrhundert waren Kanäle die effizientesten Transportwege von Massengütern. Daher plante die österreichische Verwaltung Ende des 18.Jahrhunderts ein ähnliches Kanalnetz wie in Frankreich oder England einzuführen, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Dabei war die Schaffung eines künstlichen Kanals von Wien bis zur Adria als Großprojekt geplant. Innerhalb von 6 Jahren Bauzeit wurde das erste Teilstück zwischen Wien und Wiener Neustadt 1803 fertiggestellt. Auf der 63km langen Strecke wurden zahlreiche Schleusen, Brücken, Lagerhallen und Anschlüsse an die im Wiener Becken ansässigen Industriebetriebe angelegt. Für die eigens für den Kanal entwickelten Bootstypen gründete man sogar Werften. Innerhalb von 50 Jahren entwickelte sich der Kanal zu einer der wichtigsten Transportlinien für Kohle, Holz, Ziegel und gewerbliche Produkte in die boomende Hauptstadt der Monarchie. Die weitreichenden Pläne für den Ausbau bis zur Adria mussten aufgrund finanzieller und innenpolitischer Hürden aufgegeben werden. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes verlor der Kanal zunehmend seine Funktion. Die Schiene konnte billiger, schneller und unabhängig von den Jahreszeiten massenhaft Güter transportieren. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor der Kanal endgültig seine Bedeutung, das Wiener Kanalbett wurde zugeschüttet bzw. als Trasse für die Eisenbahn genützt (teilweise die heutige Strecke der S7). Tipps und Tricks: Zum Lesen: Johannes Hradecky, Werner Chmelar: Wiener Neustädter Kanal. Vom Transportweg zum Industriedenkmal. Wien, 2014. Paul Slezak u.a.: Vom Schiffskanal zur Eisenbahn: Wiener Neustädter Kanal und Aspangbahn. Wien, 1981 Fritz Lange: Von Wien zur Adria: der Wiener Neustädter Kanal. Sutton 2003 Zum Radeln und Spazieren: Radwanderweg EuroVelo 9, Teil Wiener Neustädter Kanal. Karten findet man im Internet z.B. auf www.niederoesterreich.at…
Geschichte der Toilettenanlagen Thema: In der Geschichte der Städte stellte die Beseitigung menschlicher Fäkalien diese immer vor großen Herausforderungen. Die Verrichtung der Notdurft im öffentlichen Raum war nicht nur ein hygienisches und sittliches Problem, die Einrichtung von öffentlichen Bedürfnisanstalten wurde auch immer mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragestellungen verknüpft. Mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass nicht beseitigte Fäkalien die Auslöser für zahlreiche Krankheiten sind und dem explosiven Bevölkerungsanstieg in Wien wurden ab Ende des 18.Jahrhundert intensiv nach Lösungen gesucht, wie die enormen Mengen an menschlichen Exkrementen aus der Stadt hinaustransportiert werden könnten. So unternahm die Stadt zahlreiche Versuche, das Hygieneproblem in den Griff zu bekommen. An der Diskussion um öffentliche Toiletten entzündeten sich auch zahlreiche andere Themen, wie z.B. die der geschlechtliche Gleichbehandlung, der Klassenunterschieden und der Sexualpolitik. Ort: Die öffentliche Bedürfnisanstalt am Graben wurde 1905 im Jugendstil errichtet und sollte als Leuchtturmprojekt für die sich international repräsentierende Kaiserstadt dienen. Vor allem für Tourist*innen und Flaneure des sogenannten gehobenen Bürgertums gedacht, wurde die Toilette mit teuren Baumaterialien und den damals neuesten hygienischen Errungenschaften ausgestattet. Zeitweise mit Blumengirlanden ausgeschmückt und einem Aquarium versehen, sollte diese Toilette Anlage die Modernität und Eleganz des imperialen Wiens repräsentieren. Doch trotz des offensiv nach außen getragenen Selbstbewusstseins musste der Bau mit Kompromissen leben. So wurde die Anstalt fast verschämt in den Untergrund verbannt und es musste ein Respektabstand zum Stephansdom eingehalten werden. Die Anlage besteht heute noch und steht unter Denkmalschutz. Tipps: Zum Lesen: Luke Barclay: Es steht ein Klo im Nirgendwo, 2016 Thomas Bernhard: Alte Meister, 2008 Zum Finden: Toiletten-Apps: „Where is Public Toilet“ oder „Toilet Finder“ https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/wc/…
1 Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen 46:04
46:04  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut46:04
Plăcut46:04
Geschichte der Hausnummern in Wien Das Thema: Die sich neu formierenden europäischen Staaten des 17. Jahrhunderts mussten neue Herrschaftstechniken einführen, um auf zwei ihrer wichtigsten Ressourcen zugreifen zu können, nämlich Steuern und wehrtüchtige Männer. Um diese besser zu erfassen und zu registrieren wurden u.a. auch das System der Häusernummerierungen eingeführt. Die Doppelmonarchie machte sich seit Mitte des 18.Jahrhunderts daran, die Häuser und die darin wohnenden „Seelen“ zu erfassen. Aber auch die BürgerInnen hatten Interesse an diesem System, ermöglichte es ihnen auch für sie an Informationen zu kommen, die für sie essentiell waren. Ergänzt wurde dieses System durch die Einführung eines Informationssystems, den sogenannten Auskunftsbüros, die der Allgemeinheit gegen geringes Entgeld Informationen zu den BewohnerInnen und allgemeinen Ereignissen zur Verfügung stellten. Der Ort: Die Stadt Wien war ursprünglich auf das Gebiet des heutigen ersten Bezirkes beschränkt. Hier startete die Nummerierung mit "1" beim Sitz des Herrschers und endete in der heutigen Ballgasse 8 mit der Nummer "1343". Der Gast: Anton Tantner studierte Geschichte und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Im Sinne des Kulturhistorikers Peter Burke hinterfragt er das scheinbar Selbstverständliche und Alltägliche. Neben der Geschichte der Hausnummern geht Anton Tantner auch der Geschichte der Fragämter und Adressbüros auf den Grund. In seinen Stadtflanierien führt er Interessierte an die Orte seiner Forschung.…
Wie eine Frau die Abendschule erfand, vergessen und wieder erinnert wurde Thema: Wanda Lanzer wurde 1896 als Tochter zweier polnischer MigrantInnen unter ihrem Mädchennamen Landau in Wien geboren. Der bürgerliche elterliche Haushalt ermöglichte ihr den Besuch des Gymnasiums. Nach der Übersiedlung der Familie nach Lemberg maturierte sie dort und studierte später an der Universität Wien, wo sie mit Thema „Marxistische Krisentheorie“ promovierte. Sie wird Referentin der Sozialdemokratischen Zentralstelle für Bildungswesen. Dort entwickelt sie die Initiative für die Gründung des „Mittelschulkurses für sozialistische Arbeiter“. Nach der Heirat mit dem Juristen Felix Lanzer übernimmt sie dessen Namen. 1927-34 war sie Bibliotheksbeamtin der Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der Arbeiterkammer. Nachdem sie 1934 durch das austrofaschistische Regime entlassen wurde, musste sie 1938 aus politisch- und rassistisch-motivierter Verfolgung durch die Nationalsozialisten das Land verlassen. Im schwedischen Exil war sie Teil der Gruppe österreichischer verfolgter SozialdemokratInnen. Nach einer Periode der Entbehrungen und wirtschaftlich prekären Lebenssituation wurde Schweden für Lanzer zur zweiten Heimat. Sie arbeitete u.a. im Stockholmer Rathaus und bis zu ihrer Pensionierung im Archiv der schwedischen ArbeiterInnenbewegung. Nach 1964 kehrte sie nach Österreich zurück, wo sie weiter in der Arbeiterkammer tätig war. So bearbeitete sie unter anderem die Nachlässe von Victor und Friedrich Adler und wirkte bei der Gesamtausgabe der Werke von Otto Bauer mit. 1980 verstarb Wanda Lanzer, ihre Urne wurde nach Stockholm überstellt. Wanda Lanzer blieb lange im Schatten der offiziellen Geschichtsschreibung. Ihr Wirken fand sehr spät die ihr eigentlich zustehende öffentliche Aufmerksamkeit. Erst durch neuere Forschungs- und Publikationsarbeiten, wie unter anderem der von Barbara Kintaert und Marina Laux, wurde Wanda Lanzer wieder bekannt. Letzten Endes aber doch wurden auch in Wien nun einige Orte und Institutionen nach ihr benannt. (Wanda LanzerVolksschule, Wanda Lanzer-Park und der Wanda Lanzer-Hof). Ort: Das Abendgymnasium Wien in der Brünnerstraße 72, 1210 Wien 1925 wurde von Wanda Lanzer der Mittelschulkurs sozialistischer Arbeiter gegründet. Aufgrund ihrer intensiven Vermittlungs- und Vortragstätigkeit musste sie feststellen, dass sehr vielen wiss- und lernbegierigen jungen ArbeiterInnen die Grundlagen für ein umfassendes Verständnis von sozialen und wirtschaftlichen Umständen fehlten. Die strenge Klassenhierarchie und die Undurchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems der Zwischenkriegszeit verunmöglichte Menschen aus sozial benachteiligten Schichten den Zugang zur höheren Bildung. Der Kurs sollte junge ArbeiterInnen den Weg zur Matura ermöglichen. Bis zur Errichtung des austro-faschistischen Regimes 1934 unter Dollfuss war Wanda Lanzer Obmann des Vereins. Zwischen 1934-38 „ent-politisiert“, wurde die Initiative nach der Okkupation Österreichs durch Deutschland endgültig . Insgesamt konnten in diese Zeitraum 230 Menschen die Matura erfolgreich ablegen. Nach 1945 erfolgte die Wiedergründung als Arbeitermittelschule. 1960 als Schultyp in die Bundesverwaltung aufgenommen, entwickelte es sich als eine der erfolgreichsten Einrichtungen Österreichs in Fragen des Zweiten Bildungswegs. Bis 2014 befand sich das Gymnasium am Henriettenplatz im 15. Wiener Gemeindebezirk. An der neuen Adresse auf der Brünner Straße 72 lernen gegenwärtig über 2.000 Studierende. Der Name Abendgymnasium ist ein wenig irreführend, da die Unterrichtseinheiten modular nicht nur abends, sondern auch vor- nachmittagsweise angeboten werden. Heute wird nicht nur vermehrt das Bildungsangebot auf junge ArbeiterInnen und Berufstätige ausgerichtet, sondern auch auf BürgerInnen mit teilweisem kurzfristigem Migrationshintergrund, um diesen einen raschen Einstieg ins Bildungssystem zu ermöglichen. Der korrekte Name lautet daher auch eigentlich: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Berufstätige. Die Gäste: Ulrike Kamauf unterrichtet am Abendgymnasium Englisch und Französisch und war Mitorganisatorin zu den 100-Jahrfeierlichkeiten der Schule. Barbara Kintaert war bis zur ihrer Pensionierung Dokumentarin der Sowidok in der Bibliothek der AK Wien. Gegenwärtig beschäftigt sie sich vor allem im Bereich der Holocaust-Forschung. Marina Laux ist Erziehungswissenschaftlerin und Wirtschaftspädagogin mit den Forschungsschwerpunkte Chancengerechtigkeit und Laufbahnen, Berufsbildung, Berufseinstieg. Sie ist gegenwärtig an der Arbeiterkammer Wien beschäftigt. Tipps: Zum Lesen: Barbara Kintaert , Marina Laux: Blog des Magazins Arbeit und Wirtschaft (A&W): https://www.awblog.at/Bildung/wie-eine-frau-die-abendschule-erfand-und-vergessen-wurde-wanda Ilse Korotin: Österreichische Bibliothekarinnen auf der Flucht. Verfolgt, verdrängt, vergessen?Praesens-Verlag 2007. Irene Nawrocka: Im Exil in Schweden. Österreichische Erfahrungen und Perspektiven in den 1930 und 1940er Jahren. Mandelbaum Verlag 2013. Alfred Pfoser: Literatur und Austromarxismus. Löcker Verlag 1980…
Die Vertreibung der jüdischen Theaterszene aus Wien 1938 Der Ort: In der Weimarerstraße 83, 1190 Wien, steht die Villa der Geschwister Helene und Elise Richter. Die beiden Schwestern führten dort seit 1906 einen künstlerischen und intellektuellen Salon, in dem sich unter anderen viele Theaterfreund:innen und Künstler:innen zum Austausch trafen. Helene Richter war Anglistin und Theaterwissenschafterin, ihre Schwester Romanistin und erste Professorin an der Universität Wien. Das Haus wurde ebenfalls nach den Plänen der Schwestern gebaut. Beide Schwestern wurde ab März 1938 Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik, sie mussten ihren Besitz und ihr Haus unter Zwang veräußern. Helene Richter kam 1942 im KZ Theresienstadt zu Tode, ihre Schwester starb 1943 ebenfalls dort. Das Thema: Die Wiener Theaterszene der Zwischenkriegszeit war nicht nur für seine Inszenierungen und schauspielerischen Leistungen berühmt, sondern auch für seine lebendige und engagierte Szene. Die leidenschaftlichen Aufführungsbesucher:innen, Kritiker:innen, freiwilligen Helfer:innen und begeisterten Sammler:innen bildeten den Hummus, in der diese produktive Kunstproduktion erst möglich wurde. Viele dieser Akteur:innen waren mosaischen Glaubens bzw. wurden nach der rassistischen Zuschreibung der Nationalsozialisten als Juden definiert. Damit begann für viele dieser Theaterfreund:innen eine Geschichte der Vertreibung und Vernichtung von 1938-45. Eine Ausstellung des Theatermuseums beschäftigt sich anhand ausgewählter Biografien, welche fatalen Auswirkungen die Verfolgung durch die Faschisten auch auf die Wiener Theaterszene hatte. Die Gäste: Theresa Eckstein ist Theaterwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Universität Wien für Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Neben ihrer Forschungstätigkeit ist sie auch Ausstellungskuratorin mit dem Schwerpunkt Theatergeschichte und Jüdisches Leben. Victoria Luft ist Masterstudentin und studentische Mitarbeiterin am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Beide Wissenschaftlerinnen setzen mit ihrem methodischen Zugang der Biografienforschung der Vita Activa im Rahmen der Erinnerungspolitik ein Zeichen gegen Antisemitismus und das Vergessen. Die Tipps: Zum Hingehen: Ausstellung „Walk of Fame. Die Gleichzeitigkeit von Erfolg und Verfolgung. Bis 1.4.2024 zu besichtigen. https://www.theatermuseum.at/vor-dem-vorhang/ausstellungen/walk-of-fame/…
1 Der Republikanische Schutzbund 51:20
51:20  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut51:20
Plăcut51:20
90 Jahre nach dem Bürgerkrieg Das Thema: Der republikanische Schutzbund wurde als Antwort der Arbeiter:innenbewegung auf die zunehmende Militarisierung der rechts-konservativen Seite in Österreich und der faschistisch-autoritären Bewegungen in Italien und Ungarn 1923 gegründet. Der Schutzbund entstand aus verschiedenen Selbstverteidigungsorganisationen der Arbeiter:innenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg und sollte die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreich (SDAP) und die Gewerkschaften vor gewalttätigen Übergriffen der konservativen Heimwehren und faschistischen Gruppen schützen. Die Organisation verstand sich zwar als überparteilich, war aber eng mit der SDAP verbunden. Die Mitglieder waren militärisch organisiert, trugen Uniformen und besaßen vor allem nach dem Ersten Weltkrieg große Waffenbestände. Am Höhepunkt der Mitgliederentwicklung 1928 hatte der Schutzbund 80.000 Mitglieder. Verschiedene Faktoren führten aber ab 1927 zur Schwächung des Schutzbundes. Vor genau 90 Jahren, im Februar 1934, versuchten Teile der Organisation mit einem letzten verzweifelten Aufstandsversuch die endgültige Zerschlagung der Arbeiter:innenorganisationen und die letztendliche Beseitigung der verbliebenen Reste der parlamentarischen Demokratie zu verhindern. Der Ort: Das Wiener Arsenal war einer der größten militärisch-industriellen Komplexe der Doppelmonarchie. 1856 fertiggestellt, beherbergte es Kasernen, Verwaltungsgebäude und Produktionsstätten für Waffen. Primär weniger zur Verteidigung gegen äußere Feinde gedacht, sollte es die Wiener Bevölkerung nach der Revolution von 1848 ruhig halten. Im Objekt 19 befand sich eine Gewehrfabrik, die nach 1918 als Waffenlager für den Republikanischen Schutzbund diente. Nach mehreren vergeblichen Versuchen den Schutzbund zu entwaffnen, gelang es im März 1927 der Exekutive trotz der massenhaften Mobilisierung der in den umliegenden Bezirken wohnenden Arbeiter, einen Großteil der Waffenbestände im Objekt 19 im Zuge einer Razzia zu beschlagnahmen. Diese Polizeiaktion war einer der vielen Mosaiksteine, die zur militärischen und moralischen Schwächung des Schutzbundes führte und zur endgültigen Niederlage im Februar 1934. Der ursprüngliche Gebäudekomplex wurde Großteils in den 1980er Jahren abgerissen, stattdessen wurde auf dem Areal 1993 die Probebühne für das Wiener Burgtheater und die Staatsoper errichtet. Ab 2024 soll dort auch dort das Foto-Arsenal Wien entstehen, ein Zentrum für zeitgenössische Fotografie. Der Gast: Florian Wenninger ist Leiter des Instituts für Historische Sozialforschung, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. Er unterrichtet auch auf dem Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien, seine Forschungsschwerpunkte sind neben der Geschichte der Österreichischen Arbeiter:innenbewegung auch Diktatur- und Transformationsgeschichte wie Historische Identitätsbildung. Tipps Februar 34, Schutzbund Zum Lesen: Florian Wenninger, Lucile Dreidemy: Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933-1938. Vermessung eines Forschungsfeldes. (2013) Ilona Duczynska: Der demokratische Bolschewik. Zur Theorie und Praxis der Gewalt. (1975) Zum Schauen: Michael Scharang (Regie und Drehbuch): Die Kameraden des Koloman Wallisch. (1984) Zum Besuchen: Dauerausstellung „Das Rote Wien im Waschsalon“. Verein Sammlung Rotes Wien. Halteraugasse 7, 1190 Wien. Öffnungszeiten: Jeden Donnerstag 13-18h und Sonntag 12.-16h.…
1 Wir mussten gar nichts kochen! 38:53
38:53  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut38:53
Plăcut38:53
Das Einküchenhaus aus dem Roten Wien Inhalt: Die Grundidee des Einküchenhauses ist die Versorgung einer ganzen Wohnanlage durch eine zentral bewirtschaftete Küche, die für alle Bewohner:innen sämtliche Speisen zubereitet. Durch diese Maßnahme sollten aber nicht nur Frauen, denen diese Reproduktionsarbeit traditionell übertragen wurde, von lästiger Küchenarbeit entlastet werden, sondern auch Ressourcen und Arbeitsabfolgen rationeller und ökonomischer gestaltet werden. Mit diesem Konzept erhoffte man sich, dass die Bewohner:innen mehr Zeit auf Familie, Beruf, Freizeit und soziales Engagement verwenden können. Die Idee wurde sowohl von bürgerlichen wie sozialistischen Frauenrechtlerinnen entwickelt und propagiert. Einküchenhäuser wurden schon vor dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen europäischen Städten errichtet, eines der größten wurde im Rahmen der Bautätigkeit des Roten Wiens im 15.Wiener Gemeindebezirk 1923 errichtet. Ort: 1923 wurde in der Pilgerimgasse 22-24, 1150 Wien, ein Einküchenhaus mit 25 Wohnungen errichtet. Das Gebäude umfasste neben den Wohneinheiten und der Zentralküche auch eine Wäscherei. Die Speisen wurden über einen Aufzug in die Wohneinheiten verbracht, Reinigung und Beheizung wurde ebenfalls zentral organisiert. Die Anlage wurde 1925 auf insgesamt 246 Wohneinheiten mit weiteren Sozialräumen und einer Bibliothek erweitert. Das Experiment des Einküchenhauses wurde später wieder zurückgebaut, heute haben alle Wohneinheiten eine eigene Küche, die Zentralküche ist stillgelegt. Ein Vorläufer des Komplexes Pilgerimgasse befindet sich in der Peter-Jordan Straße 32-34, 1190 Wien. Dieser „Heimhof“ war aber nicht für ganze Familien, sondern für alleinstehende Frauen gedacht, die nur ein Zimmer bewohnten. Gäste: Christina Schraml ist Urbanistin und forscht und lehrt an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Marie Noelle Yazdanpanah ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig Boltzman-Institute for Digital History. Beide beschäftigen sich seit langem mit dem Konzept des Einküchenhauses und sind im Verein zur Erforschung emanzipatorischer Wohnmodelle aktiv. Tipps EKH Zum Lesen Günther Uhlig: Kollektivmodell „Einküchenhaus“. Wohnreform und Architekturdebatte zwischen Frauenbewegung und Funktionalismus 1900–1933. (1981) Danilo Udovički-Selb: Moisej J. Ginzburg, Ignatij F. Milinis: Narkomfin, Moscow 1928–1930 (2016) Im Netz: Marie-Noëlle Yazdanpanah, Kurzfilm „Frauen Wohnen Wien“: https://www.youtube.com/watch?v=Yuul8SHqFnE www.einkuechenhaus.at https://topos.orf.at/vor-100-jahren-einkuechenhaus100…
1 Heanois is ois! - Der Wiener Sport-Club 41:21
41:21  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut41:21
Plăcut41:21
Und der älteste heute noch bespielte Fussballplatz Wiens Tipps Zum Lesen: Michael Almasi-Szabo: „Von Dornbach in die ganze Welt. Die Geschichte des Wiener Sportklubs. 2017 Christian Bunke: Wiener Sportklub. Fußballfibel. Fans schreiben für Fans. Fanmagazin „Alszeilen“. Erscheint bei jedem Heimspiel neu. Roman Horak: Mehr als nur ein Spiel. Fußball und populare Kultur im Wien der Moderne. 1997 Renate Mowlam: Der Wiener Sport-Club – Von 1883 bis heute. Ein Comic. Zum Schauen: Next Goal Wins. Dokumentation 2014 Next Goal Wins. Spielfilm 2023. Jetzt im Kino. Der Ort Wiener Sport-Club Platz, Alszeile 19, 1170 Der Sportclubplatz wurde 1904 errichtet und ist somit das älteste noch bestehende Fußballstadion Kontinentaleuropas. Hier wurden auch die meisten Heimspiele des WSC ausgetragen und er ist auch heute noch der Austragungsort vieler Freundschaftsspiele anderer Mannschaften. Das Stadion bietet die klassische englische Fußballatmosphäre, liegt es doch inmitten des Bezirks Hernals zwischen Wohnhäusern und dem Hernalser Friedhof. Von diesem Friedhof leitet sich auch der Name der berühmten Nordtribüne ab, der sogenannten Friedhofstribüne, von der aus die WSC-Fans ihre Mannschaft anfeuern. Leider befindet sich das Stadion seit langer Zeit in dringend renovierungsbedürftigen Zustand. Nach langer Durststrecke besteht die Hoffnung, dass der Platz in absehbarer Zukunft wieder im alten Glanz erstrahlt. Das Thema Das im Stadtteil Dornbach in Wien Hernals errichtete Stadion dient von Beginn an als Heimstätte des Wiener Fußballklubs WSC. Am Anfang des Wiener Sportclubs stand aber nicht der Fußball, sondern andere Sportarten: Vor allem Fahrradfahren und Rudern. Aus dem von sportbegeisterten bürgerlichen Honoratioren gegründete Verein entwickelte sich einer der wichtigsten Wiener Fußballvereine, der vor allem in den 1950er und 60ern seine erfolgreichste Zeit hatte. Der WSC steht aber auch für den stetigen Abstieg des Wiener Vereinsfußballs seit den 1970er Jahren. Zwei Konkurse zwangen ihn in die Dritte Liga. Gleichzeitig entwickelte sich aber auch eine hochaktive Fanszene, die den Verein nicht nur schon mehrmals rettete, sondern auch für selbstbestimmtes und engagiertes Klubleben steht. Zu Gast Sebastian Schönbauer ist einer der beiden Archivare des Wiener Sport-Clubs, Aktivist auf der Friedhofstribüne und Hard-Core Fan des WSC seit vielen Jahren. Er ist auch Kuratoriumsmitglied des Vereins und natürlich Dauergast auf der Friedhofstribüne.…
Eine kurze Sonderausgabe zum historischen Hintergrund des ersten Neujahrskonzerts Der Ort Musikvereinsplatz 1, 1010 Der Wiener Musikverein gibt als eines der traditionsreichsten Konzerthäuser dem Musikvereinsplatz in Wiens erstem Bezirk seinen Namen. 1812 als Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gegründet, wurde das heutige Gebäude im Jänner 1870 mit einem feierlichen Konzert bezogen. Der historisierende Stil soll klarstellen, dass es sich hier um einen „Tempel der Musik“ handelt. Es ist der Ort, an dem natürlich auch traditionell das Neujahrskonzert stattfindet. Das erste Neujahrskonzert ging hier am 31. Dezember 1939 über die Bühne. Das Thema In diesem kurzen Special gehen wir der Geschichte des Neujahrskonzert auf den Grund. Das Neujahrskonzert gilt als eines der größten heimischen Medienereignisse, wird in die ganze Welt ausgestrahlt und steht wie wenig andere Veranstaltungen für klassische bis klischeehafte „Österreichbilder“. Doch welche „Traditionen“ stehen dahinter und wann fing das alles eigentlich an? Tipps Zum Lesen: Fritz Trümpi: Politisierte Orchester. Die Wiener Philharmoniker und das Berliner Philharmonische Orchester im Nationalsozialismus. 2011 Bernadette Mayrhofer, Fritz Trümpi: Orchestrierte Vertreibung. 2014 Fred K. Prieberg: Musik und Macht. 2015…
Historische Hausbesetzungen in Wien Der Ort Stiftgasse, 1070 Das Amerlinghaus ist ein selbstverwaltetes Kulturzentrum, das sich seit den 1970er-Jahren im ehemaligen Wohnhaus von Friedrich von Amerling im siebten Wiener Gemeindebezirk befindet. Nach einem mehrtätigen Grätzelfest und einer darauf folgenden Hausbesetzung wurde hier 1975 der Grundstein für das erste autonom verwaltete Kulturhaus Wiens, das Amerlinghaus, gelegt. Es galt, mehrere denkmalgeschützte Biedermeier Häuser vor dem Abriss zu retten. Nach langen Verhandlungen wurde dieses Haus renoviert und einem Kulturverein zur Selbstverwaltung übergeben, welche auch heute noch existiert. Das Thema Bei Hausbesetzungen geht es um die Aneignung von leerstehenden Räumen, um sie als Wohn- und/oder Kulturfläche zu nutzen, ganz nach dem Motto, die Häuser denen, die drin wohnen! Der rapide Zerfall innerstädtischer Wohn- und Arbeitsplatzstruktur der Wiener Innenbezirke während der 1960er und 70er Jahre ließ tausende Wohnungen trotz enormem Wohnungsbedarf leer stehen. Diese Entwicklung bildete die politische Grundlage der aufkeimenden HausbesetzerInnenszene. In diesem Podcast wollen wir der Geschichte von Hausbesetzungen in Wien nachgehen, die Szene mit der anderer Städte vergleichen und einen Überblick über die Entwicklung und den theoretischen Hintergrund dieser politischen Aktionsform über die Jahrzehnte geben. Zu Gast Unser Studiogast, Robert Foltin, gilt als „Chronist der Bewegung“ und setzt diese Entwicklung in einen Zusammenhang mit dem Aufbrechen von Disziplinargesellschaft und Fordismus. Hausbesetzungen hatten unterschiedliche Gründe und Ziele, waren aber besonders dann umstritten, wenn sie „als ein Stachel in der Normalität“ fungierten. So entstand zeitweise ein „neuer Typus sozialer Organisation“ zwischen dem „Privaten“ und „Öffentlichen“ als ein Versuch der Selbstverwaltung. Robert Foltin ist Autor, Pensionist, Theoretiker, Philosoph, Politaktivist, Queere Aktivist*in, Linguist und Phonologe – mehr dazu unter: www.robertfoltin.net Tipps Zum Hören: Drahdiwaberl: Der Terrorprofi aus der BRD. Auf: McRonalds Massaker Zum Lesen: Robert Foltin: Und wir bewegen uns doch. Soziale Bewegungen in Österreich. 2004 Robert Foltin: Und wir bewegen uns noch. Zur jüngeren Geschichte sozialer Bewegungen in Österreich. 2011 Andreas Suttner: „Beton brennt“: Hausbesetzer und Selbstverwaltung im Berlin, Wien und Zürich der 80er. 2011 Katalog des Wien Museums: Besetzt! (Ausstellungskatalog 2012) Martin W. Drexler; Markus Eiblmayr, Franziska Maderthaner (Hg.): Idealzone Wien: Die schnellen Jahre (1978-1985). 2016 Werner Faulstich: Die Kultur der 60er Jahre. Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 2003 Werner Faulstich: Die Kultur der 70er Jahre. Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. 2004…
1 Ein Palast des Wissens für das Volk: Das Volksheim Ottakring 52:41
52:41  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut52:41
Plăcut52:41
Volkshochschulen und Erwachsenenbildung im Wandel der Zeit Der Ort Ludo-Hartmann-Platz, 1160 Die heutige Volkshochschule Ottakring wurde 1901 als „Volksheim Ottakring“ auf Initiative von Ludo Moritz Hartmann und Emil Reich als Einrichtung der Erwachsenenbildung gegründet. Gerade in der Zwischenkriegszeit des „Roten Wien“ hatte sie eine große Bedeutung und zahlreiche prominente Vortragende. Auch heute noch ist das historische Haus am Ludo-Hartmann-Platz einer der größten und bedeutendsten Standorte der Wiener Volkshochschulen, mit besonderen Schwerpunkten im Bereich der Bildungsarbeit mit Migranten und der Bildungsarbeit mit Jugendlichen, sowie umfassenden Angeboten in den Bereichen Sprachen und Bildungsabschlüsse („Zweiter Bildungsweg“). Das Thema Ein Palast des Wissens für das Volk: Das Volksheim Ottakring Volkshochschulen und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Erwachsenenbildung Bildung ist ein Fundament unserer Gesellschaft. Sie führt zu mehr Chancengerechtigkeit und stärkt die Demokratie. Der Zugang zu Bildung und besonders zu Hochschulbildung ist keine Selbstverständlichkeit. Er wurde erst vor wenigen Jahrzehnten ermöglicht und in den letzten 20 Jahren auch wieder eingeschränkt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Universitäten noch restriktiver. Frauen und Arbeiter*innen konnten nicht studieren, auch ein zweiter Bildungsweg war nicht möglich. So kam es zu Initiativen, die auch den Unterprivilegierten Anteil an Wissensproduktion und -erwerb ermöglichen sollten. Das Volksheim Ottakring war ein erster Meilenstein, der Bildung bis hin zum Hochschulniveau und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen sollte und den Kern der heutigen Volkshochschulen bildete. Seither hat sich viel verändert, die Institution steht vor den Herausforderungen des digitalen, postmodernen Zeitalters. Über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Erwachsenenbildung sprechen wir daher mit dem Generalsekräter der Österreichischen Volkshochschulen, Dr. John Evers. Zu Gast John Evers absolvierte zunächst eine Buchhändlerlehre, erwarb im zweiten Bildungsweg die Berufsreifeprüfung und studierte Geschichte. 2007 promovierte er mit Auszeichnung und war daneben beruflich von 2003 bis 2007 Geschäftsführer des Gedenkdienstes. Danach arbeitete er wieder bei den Wiener Volkshochschulen. In seine Zuständigkeit fielen insbesondere die Angebote aus dem Bereich Basisbildung und Pflichtschulabschluss-Kurse, deren größter Träger die Volkshochschulen im Rahmen des Förderprogramms Initiative Erwachsenenbildung sind. Seit 2022 ist der „Erwachsenenbildner mit Leib und Seele“ Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen.…
1 Dr. Reinhardt Brandstätter und die AIDS-Hilfe 32:10
32:10  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut32:10
Plăcut32:10
Mit Selbstorganisation gegen Diskriminierung Der Ort Reinhardt-Brandstätter-Platz, 1060. Am 1. Dezember 2022 wurde die Verkehrsfläche vor der Aids Hilfe Wien in Dr. Reinhardt Brandstätter-Platz in einem feierlichen Festakt umbenannt. Brandstätter war ein Gründungsmitglied der Österreichischen AIDS-Hilfe und ein engagierter Aktivist der damaligen Lesben- und Schwulenbewegung. Er verstarb nach langer Krankheit an den Folgen von HIV/AIDS im Jahr 1992 Das Thema HIV/AIDS taucht vor genau 40 Jahren in den österreichischen Medien auf. Die Hysterie ist groß, Unwissen und Verunsicherung schüren Vorurteile. Schnell ist von einer „Schwulenseuche“ die Rede. Zwangsmassnahmen bis hin zu Tätowierungen und Internierungslagern werden diskutiert. Der Aktivist und Arzt Dr. Reinhardt Brandstätter reagiert schnell mit einer Informationsbroschüre, die falschen Vorstellungen entgegentreten soll und zeitgleich für Bewusstsein und Prävention sorgen soll. In der Folge gründet er die Österreichische AIDS-Hilfe. Über die einstige Selbstorganisation Betroffener, die damit eingehende Veränderung im Selbstbewusstsein von NGOs und den heutigen Aufgaben in der Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten sprechen wir mit unserem Gast, Andrea Brunner. Zu Gast Andrea Brunner wurde in Schwaz in Tirol geboren und studierte Politikwissenschaft in Wien. Sie war Vorsitzende der Hochschüler*innenschaft an der Universtität Wien, später Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ Frauen und stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Seit 2020 ist die Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien. Tipps Zum Hören: Radio Orange: Radio Positiv. Die Sendereihe der AIDS-Hilfe Wien. Jeden Donnerstag, 20.00 Zum Hören bzw. Ansehen: Matteo Haitzmann: Those we lost – a visual concert Zum Schauen: „It’s a sin“: Britische Miniserie, 5 Folgen, Channel 4 (2021) Rosa von Praunheim: Ein Virus kennt keine Moral (1986) Zum Lesen: Rebecca Makkai: Die Optimisten (2021) bzw. das Original: The Great Believers (2018) Jürgen Bauer: Das Portrait (2020) Zum Selber-Hingehen: Das AIDS Memorial bei der Wallfahrtskirche Maria Grün im Prater. Dortiger Pfarrer: Pater Clemens Kriz, AIDS-Seelsorger…
Sozialkritik und das Bild der "Neuen Frau" im Leben einer Internationalistin Der Ort Hotel Prinz Eugen, Wiedner Gürtel 14, 1040 Wien. Das heutige Hotel „Prinz Eugen“ am Wiedener Gürtel 14 war eine von drei bekannten Adressen der Schriftstellerin Maria Leitner in Wien. Hier lebte sie auf der Flucht vor den Schergen des faschistischen Horthy-Regimes. Hotels waren historisch auch immer ein Rückzugsort vor den Blick von Polizei und Denunziant*innen. Am gefährlichen Rand der Dinge waren diese Orte Asyl, Info-Börse und Arbeitsplatz zugleich. Das Thema Das Leben der Schriftstellerin, Journalistin und politischen Kämpferin Maria Leitner war abenteuerlich. In eine jüdische Familie der damaligen ungarischen Reichshälfte geboren, erlebt sie nach dem ersten Weltkrieg die Errichtung der Räterepublik und die Grauen des reaktionären weißen Terrors. Über Wien flieht sie nach Berlin, arbeitet für unterschiedliche Zeitungen und hinterläßt uns sowohl politische Romane als auch pointierte Reisereportagen, die eines gemeinsam haben: Die Sicht der Subalternen und des Prekariats sowie ein Bild der „Neuen Frau“ und ihr Ringen um politische Teilhabe in einer Welt, die abermals kurz vor dem Abgrund steht. Zu Gast Stephanie Marx lehrte am Institut für Germanistik der Universität Wien und forscht zur politischen Literatur der Zwischenkriegszeit. Sie publizierte zum Leben und Werk der Maria Leitner in der Österreichischen Zeitschrift für Geschichte (ÖZG 3/22): Ein Mädchen, drei Namen. Die politische Teilhabe neuer Frauen bei Maria Leitner. Sie ist Mit-Herausgeberin des Bandes „Literatur und Care“ (Verbrecher Verlag, Berlin: 2023). Tipps Im Netz: John-Heartfield-Exhibition Zum Lesen: Stefanie Marx: Ein Mädchen, drei Namen. Die politische Teilhabe neuer Frauen bei Maria Leitner. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, Heft 3/2022 Julia Killet: Maria Leitner oder: Im Sturm der Zeit (2013) Maria Leitner: Reportagen aus Amerika : eine Frauenreise durch die Welt der Arbeit in den 1920er Jahren. (1999) Anke Stelling: Bodentiefe Fenster (2015) Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen (2018) Mithu Sanyal: Identitti (2021) Fatma Aydemir: Dschinns (2022)…
1 Im wilden Dschungel der Mehrsprachigkeit 51:38
51:38  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut51:38
Plăcut51:38
Märkte als Orte der Begegnung und der Sprachenvielfalt Der Ort Der Brunnenmarkt in Wien Ottakring, 1160 Das Thema Sprachforscher und Erwachsenenbildner Thomas Fritz besucht als Gast gemeinsam mit der Geschichtsgreisslerei den Wiener Brunnenmarkt und erklärt anhand der Methode der „Linguistic Landscape“, wie vielsprachig der Stadtteil um dem Markt ist und welche wichtige Rolle öffentliche Märkte für die kulturelle, soziale und politische Entwicklung von Metropolen spielen. Zu Gast Thomas Fritz ist Sprachenforscher und Erwachsenenbildner. Er ist Gründer des lernraum.wien der Wiener Volkshochschulen und lehrt am Institut für Germanistik an der Universität Wien im Fachbereich DaF/DaZ. Tipps Im Netz: Dokumentation der Ausstellung „linguistic landscapes – Mehrsprachigkeit from Below“ von Thomas Fritz www.vhs.at/de/e/lernraum-wien www.geschichtewiki.wien.gv.at/Markt Zum Lesen: Thomas Fritz: Super, divers und mehrsprachig in Basisbildung und DaZ-Kursen, edition Volkshochschule, Wien 2020 Alastair Pennycook, Emi Otsuji: Metrolingualism. Language in the City. New York 2015 Alastair Pennycook: Language and Mobility: Unexpected Places. Bristol 2012 Vera Ahamer: Unsichtbare Spracharbeit. Jugendliche Migranten als Laiendolmetscher. Integration durch „Community Interpreting“. Bielefeld 2013 Manfred Chobot und Petra Rainer: Der Wiener Brunnenmarkt oder Wie man in der eigenen Stadt verreist. Wien 2012. Zum Hören: Podcast der IPU Berlin: Aladin El-Mafaalani: Zwischen Diskriminierung und Anerkennung: Potenziale und Herausforderungen in der superdiversen (Klassen-) Gesellschaft Zum Selber-Hingehen: Sprachcafé jeden Montag um 17 Uhr im Stand 129 am Viktor Adler Markt…
1 Die Seidenraupe ist der beste Steuerzahler 38:17
38:17  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut38:17
Plăcut38:17
Neubau und die Gentrifizierung Der Ort Schottenfeldgasse Das Thema Neubau und die Gentrifizierung Diese Folge führt uns ausgehend von der Schottenfeldgasse in Wien Neubau von der frühen Textil- und Seidenindustrie des 18. und 19. Jahrhunderts bis in die schicken Boutiquen und Design Stores in den heutigen Bezirken Sechs und Sieben. Und es geht um die Gentrifizierung und ihre Bedingungen – damals wie heute.…
Das Gebär- und Findelhaus in Wien Der Ort Im Hof Nummer 7 des Alten AKH und auf der Alserstraße/Ecke Lange Gasse im 9.Bezirk befanden sich das Wiener Gebär- und das Findelhaus von 1784-1910. Während das Wiener Findelhaus abgerissen wurde, existieren die Räumlichkeiten der ehemaligen Gebärklinik für ledige Frauen nach wie vor im Alten AKH. Das Thema Im Zuge der Reformpolitik Joseph II wurde mit der Einrichtung der beiden Häuser ledigen Schwangeren die Möglichkeit geboten, ohne Strafverfolgung und mit einem Mindestmaß an medizinischer und sozialer Unterstützung ihre Kinder zur Welt zu bringen und sie staatlicher Obhut zu übergeben. Diese Maßnahmen entsprangen aber nicht nur humanistischen Überlegungen, sondern sollten auch dem kontrollierten Bevölkerungswachstum eines expandierenden Militär- und Steuerwesens dienen. Und auch in der Behandlung der Frauen machten sich große Unterschiede je nach Klassenzugehörigkeit bemerkbar. Zu Gast Dr. Verena Pawlowski ist Historikerin in Wien und setzt ihren Schwerpunkt vor allem in Folgegeschichte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Österreich. Sie ist auch Autorin der umfassenden Studie, die die Geschichte dieser beiden Einrichtungen multiperspektivisch behandelt: „Mutter ledig, Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien 1784 – 1910. Wien 2001“.…
1 Von Kathedralen der Moderne, Skihallen und Fischfabriken 48:10
48:10  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut48:10
Plăcut48:10
Der Wiener Nordwestbahnhof und die Brigittenau Der Ort Der Wiener Nordwestbahnhof und die Brigittenau Das Thema Bahnhöfe waren und sind besondere Orte. Als Kathedralen der Moderne zogen sie früher alle möglichen Menschen an: Reisende, Arbeiter innen, Randexistenzen, Glücksritter und Demagog innen. Heute müssen ganz oder teilweise großen Wohn- und Geschäftsprojekten weichen. Der Nordwest-Bahnhof war der wichtigste Wiener Bahnhof der Doppelmonarchie. In den 1870er Jahren errichtet war er eines der größten infrastrukturellen Projekte der Kaiserstadt und sollte die Metropole mit den wichtigen Industrie- und Agrargebieten in Böhmen und Mähren verbinden. Das über 40ha große Gelände teilte den Bezirk Brigittenau für über 150 Jahre in zwei Teile. Der größte Bahnhof der Kaiserstadt durchlief eine äußerste wechselhafte Geschichte. Von der Hauptanlaufstelle für Waren und Menschen aus der Monarchie hin zu einem wirtschaftlichen und infrastrukturellen Problemkind der Ersten Republik bis zur Neuerfindung als Bahn-LKW Umschlagterminal in den 1960er Jahren, der als Verkehrsknotenpunkt für eine Wirtschaftslinie agierte, die von der Nordsee bis in den Iran reichte. Er war Filmkulisse, Schrottplatz, Skipiste, Fischfabrik, Aufmarschplatz der Austrofaschisten und Nazis und Ausstellungsort für Anti-Semitische Ausstellungen der schlimmsten Ausprägung. Mit der endgültigen Stilllegung in den 2010er Jahren findet das Areal eine neue Nutzung durch intensive Wohnraumbewirtschaftung. In den nächsten Jahren sollen dort 17.000 NeubewohnerInnen des Bezirks ansässig werden, was eine massive Veränderung des gesamten Bezirks mit sich bringen wird. Tipps Zum Lesen: Bernhard Hachleitner, Michael Hieslmair, Michael Zinganel: Blinder Fleck Nordwestbahnhof. 2022 Zum Selber-Hingehen: Museum Nordwestbahnhof. Nordwestbahnhof 16a, 1200 Wien. Jeden Donnerstag 15.00-18.00 geöffnet (Eintritt frei) Besuch des Nordwestbahnhof: Noch ist das Gelände frei begehbar. Eingänge entlang der Nordwestbahnstraße und Am Tabor beim Gelände…
1 Psychologie im Nationalsozialismus: Die Erziehungsanstalt Kaiserebersdorf 48:08
48:08  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Redare mai Târziu
Redare mai Târziu  Liste
Liste  Like
Like  Plăcut48:08
Plăcut48:08
Psychologie zwischen Reformpädagogik und Erbbiologie Der Ort Das Schloss Kaiserebersdorf an der Kaiser-Ebersdorfer-Straße 297 im 11. Wiener Gemeindebzirk hat eine lange Geschichte. Im 16. Jahrhundert wurde das festungsartige Gebäude in ein Jagd- und Lustschloss umgebaut. In der zweiten Türkenbelagerung wurde es zerstört, danach im barocken Stil wiederaufgebaut und diente in der Folge als Sommerresidenz der Habsburger Herrscher. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts beherbergte es eine Kaserne. In den späten 1920er Jahren wurde hier die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige eingerichtet, in welcher auch mit Hilfe der damals neuen „psychotechnischen Verfahren“ (heute: „entwicklungspsychologische Diagnostik“), sozial schwer integrierbaren oder kriminellen Jugendlichen eine Integration in die Gesellschaft ermöglicht werden sollte. Diese – leider bald berüchtigte – Bundesanstalt wurde 1974 geschlossen. An ihre Stelle traten von der Bewährungshilfe geführte offene Wohngemeinschaften. In Kaiserebersdorf selbst wurde 1975 die Justizvollzugsanstalt Simmering eröffnet, die 1994 bis 1999 den charakteristischen neuen Anbau erhielt. Das Thema Nach dem Inkrafttreten des am 18. Juli 1928 beschlossenen Jugendgerichtsgesetzes wurde mit 1. Jänner 1929 das ehemalige Schlossareal als Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige zur Unterbringung schwer erziehbarer Kinder und Jugendlicher genutzt. Geleitet wurde die für die damalige Zeit moderne Erziehungsanstalt von Richard Seyß-Inquart, dem Bruder des späteren nationalsozialistischen Bundeskanzlers und NSDAP-Funktionärs Arthur Seyß-Inquart. Richard Seyß-Inquart setzte jedoch auf pädagogische und psychologische Maßnahmen, sein Grundsatz war „Ihr sollt nicht strafen, bessern sollt ihr“. Die Anstalt sollte also Jugendlichen über Erziehung und Arbeit und unter Einbeziehung moderner (entwicklungs-)psychologischer Messverfahren („Wofür interessiere ich mich? Was kommt mir enbtgegen?“) eine zweite Chance zur Integration in die Gesellschaft ermöglichen. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938, dem Tod Richard Seyß- Inquarts und der Übernahme der Leitung durch den vormals illegalen Nationalsozialisten Otto Schürer-Waldheim wandelte sich die Anstalt in ein Repressionsinstrument gegen sozial deviante Jugendliche. Die Jugendlichen wurden gequält, mussten für die Wehrmacht arbeiten und wurden zum Teil in den letzten Kriegstagen in Strafbataillonen verheizt. Auch die angewandten psychologischen Methoden stellten sich in den Dienst der rassistischen und biologistischen NS- Ideologie. Den repressiven Charakter behielt sie auch nach der Befreiung 1945 in vielerlei Hinsicht bei. Sie wurde nun dem Justizministerium unterstellt, ein großer Teil des Personals wurde aber einfach übernommen. Die Jugendlichen kamen alle aus ärmlichen Verhältnissen, fast alle aus unvollständigen Familien, viele hatten als Waisen bereits lange Heimkarrieren hinter sich oder sie kamen deshalb nach Kaiser-Ebersdorf, weil ihre Stiefväter sie misshandelten. Auch sexuell missbrauchte und Kinder von Opfern des Nationalsozialismus waren darunter. In den Schriftstücken wie Führungsakten, Erhebungs- und Gerichtsberichten, beschrieben die Verantwortlichen die Jugendlichen mit Adjektiven wie zum Beispiel „muffig“, „grenzdebil“, „hemmungslos“, „hinterhältig“, „renitent“, „primitiv“, „faul“ oder „tiefgehend verwahrlost“. Sie sahen nichts Positives in den jungen Menschen. Die Zustände waren auch in der Folge so schlimm, daß es Ende der 1940er und in den 1950er Jahren zu Aufständen in der Anstalt kam, die unter Zuhilfenahme der Bereitschaftspolizei brutal unterdrückt wurden. Erst im Zuge der fortschrittlichen Justizreformen in der sozialdemokratischen Regierung Kreiskys wurde dieser Zustand beendet und die Anstalt geschlossen. Die Sendung behandelt den historischen Hintergrund der Anstalt und der dort erstmals in Österreich angewandten neuen psychologischen Methoden von der christlich-sozialen Ethik und den Sozialreformen des roten Wien hin zur erbbiologistischen und rassistischen Unterdrückungspolitik der nationalsozialistischen Diktatur bis zur Nachkriegszeit und den hier wirkenden Kontinuitäten. Zu Gast Martin Wieser studierte Psychologie und Philosophie an der Universität Wien und der Freien Universität Berlin. Von 2010 bis 2014 war er Fellow am interdisziplinären Doktoratskolleg „Die Naturwissenschaften im historischen, philosophischen und kulturellen Kontext“ am Institut für Geschichte der Universität Wien sowie Dozent an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien. 2013 arbeitete er als Research Fellow am Graduate Program „History and Theory of psychology“ der York University in Toronto, 2014 als Gastwissenschaftler an der HU Berlin am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte. 2013 promovierte er im Fach Psychologie an der Universität Wien, 2014 ebendort in Philosophie. Von April 2016 bis März 2020 war er Projektmitarbeiter in dem Forschungsprojekt „Psychologie in der Ostmark“ an der SFU Berlin, seit 2020 ist er Projektleiter des Nachfolgeprojekts „Theorie, Praxis und Konsequenzen der Operativen Psychologie“.…
Historische Seuchen und Parallelen zur Corona Pandemie Der Ort Die Kirche der Heiligen Thekla im 4.Bezirk Das Thema Die erste Folge der Geschichtsgreißlerei untersucht die historischen Choleraepidemien im Wien des 19. Jahrhunderts und vergleicht sie mit der jüngsten Corona-Pandemie. Dabei wird klar: Seuchen sind gerade im städtischen Raum Katalysatoren für Innovation. Die soziale Frage bleibt entscheidend, wenn es um Bewältigung von Seuchen geht. Tipps Im Netz: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: So geht’s uns heute: die sozialen Folgen der Corona-Krise. 2012. Downloadbar von der Ministeriums-Homepage. Zum Lesen: Andreas Weigel: Cholera: eine Seuche verändert die Stadt. In: Wiener Geschichtsblättern Heft 98 (2018) Zum Selber-Hingehen: Wiener Wasserwanderweg. Broschüre zum Downloaden…
Bun venit la Player FM!
Player FM scanează web-ul pentru podcast-uri de înaltă calitate pentru a vă putea bucura acum. Este cea mai bună aplicație pentru podcast și funcționează pe Android, iPhone și pe web. Înscrieți-vă pentru a sincroniza abonamentele pe toate dispozitivele.